Ein Elektromotor im Rad klingt nach einer simplen Idee, erweist sich im Automobilbau jedoch als technisch anspruchsvolle Lösung. Bei E-Bikes und E-Rollern sind Radnabenmotoren seit Jahren erprobt und weit verbreitet, doch im Auto fristen sie bislang ein Nischendasein. Ihr Prinzip ist dabei ebenso klar wie bestechend: Der Motor sitzt nicht zentral im Fahrzeug, sondern direkt in der Radnabe und überträgt seine Kraft ohne Umwege über Getriebe, Kardanwelle oder Differenzial unmittelbar auf die Straße.
Ganz neu ist der Ansatz freilich nicht. Schon Ende des 19. Jahrhunderts experimentierten der Wiener Wagenbauer Ludwig Lohner und der junge Ferdinand Porsche mit Nabenmotoren. Modelle wie Semper Vivus, Phaeton oder Mixte nutzten Radnabenantriebe an einer oder gleich beiden Achsen, teils in Kombination mit einem Verbrenner. Damit entstanden die ersten allradgetriebenen und sogar hybriden Fahrzeuge der Welt. Zwar erwiesen sich die Motoren damals als zu schwer und die Batterien als zu schwach, doch das Konzept sorgte schon früh für Schlagzeilen und später für Einträge in die Geschichtsbücher. Die Lohner-Porsche-Ära und damit die erste Karriere des Radnabenmotors im Automobilbau endete 1906.
In den folgenden Jahrzehnten tauchte der Radnabenmotor zwar immer wieder in Ingenieursstudien und Kleinserienprojekten auf, konnte sich jedoch nie wirklich durchsetzen. Die Gründe dafür waren technischer und praktischer Natur: Die ungefederten Massen an den Rädern nahmen zu, die Motoren waren vergleichsweise anfällig gegenüber Schmutz, Wasser oder Steinschlag und die Batterien lieferten zu wenig Energie. Mit dem Aufkommen leistungsfähiger Mittelmotor- und Achsantriebe geriet die Nabenlösung ins Hintertreffen, wenngleich sie nie vollständig verschwand.
Technik verstehen - Vom Elektroantrieb zum Scheinwerfer
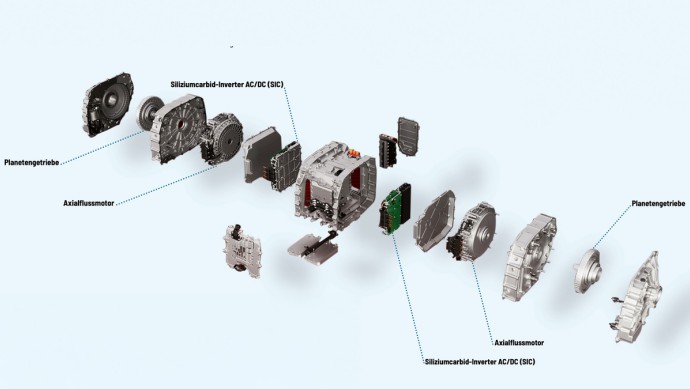 Bildergalerie
Bildergalerie
Heute, im Zeitalter der Elektromobilität, erlebt die Idee eine Renaissance. Start-ups wie Protean Electric oder Elaphe sowie etablierte Zulieferer wie Astemo haben den Radnabenmotor modernisiert und optimiert. Und obwohl er sich bislang nicht als Mainstream-Technologie etablieren konnte, gilt er nach wie vor als heißer Kandidat, um künftige E-Fahrzeuge anzutreiben. Diese Lösung könnte unter anderem viel Platz im Innenraum und den Designern neue Spielräume für die Karosserie schaffen.
Radnabenmotor: Sonderform des Außenläufermotors
Technisch gesehen ist der Radnabenmotor eine Sonderform des Außenläufermotors. Der Elektromotor sitzt dabei wie eine ringförmige Trommel um die Radnabe. Der Stator, also das unbewegliche Bauteil mit den Spulen, ist fest mit der Radaufhängung verbunden. Um ihn herum dreht sich der Rotor, der Permanentmagnete trägt und direkt mit der Felge verschraubt ist. Fließt Strom durch die Spulen, entsteht ein Magnetfeld, das den Rotor und damit das Rad in Bewegung setzt.
Das Besondere daran ist, dass der Radnabenmotor ohne Zwischenglieder arbeitet. Es werden weder Getriebe noch Antriebswellen benötigt, die die Motorkraft an die Räder übertragen. Das bietet zwei Vorteile: Die Effizienz ist hoch und jedes Rad lässt sich individuell steuern. In Kombination mit entsprechender Rechnerleistung und intelligenter Software eröffnen sich enorme fahrdynamische Potenziale: Die Drehmomentverteilung kann in Millisekunden erfolgen, es ist möglich, radselektiv zu bremsen und sogar das „Drehen auf der Stelle“ wie bei einem Kettenfahrzeug ist mit vier Radnabenmotoren prinzipiell möglich.
Auch interessant:
- Wie funktioniert eigentlich: Das Fernlicht
- Wie funktioniert eigentlich: Die Hupe
- Wie funktioniert eigentlich: Die Zapfpistole
Die Konstruktion bringt allerdings auch Herausforderungen mit sich. Da Motor, Elektronik und gegebenenfalls auch die Bremse direkt im Rad untergebracht werden müssen, steigt die ungefederte Masse pro Rad deutlich an. Das beeinträchtigt wiederum Komfort und Fahrdynamik. Zudem ist der Platz im Rad begrenzt, weshalb Kühlung und Robustheit besondere Aufmerksamkeit erfordern. Schließlich sind die Motoren am Rad den härtesten Bedingungen ausgesetzt: Schlaglöcher, Wasser, Salz, Schmutz und Vibrationen wirken permanent auf das Bauteil ein.
Leichte Materialien, bessere Abdichtungen und neue Kühlkonzepte
Ingenieure arbeiten daher an leichten Materialien, besseren Abdichtungen und neuen Kühlkonzepten, um diese Schwachstellen zu minimieren. Fortschritte in der Leistungselektronik sowie kompaktere Bauformen machen die Technik heute attraktiver denn je. Auch die inzwischen sehr leistungsstarken Batterien rücken die E-Mobilität und damit den elektrischen Radnabenmotor wieder stärker in den Fokus.
Ein weiterer Vorteil: Radnabenmotoren schaffen Platz im Fahrzeug. Wo sonst Motor und Antriebsstränge untergebracht werden müssen, ist Platz für den Innenraum. So lassen sich kleine Autos mit großen Fahrgastzellen realisieren. Das gilt ebenso für kleine Busse oder leichte Nutzfahrzeuge. Hier verspricht der Radnabenmotor erhebliche Packaging-Vorteile. Auch für autonome Shuttle-Fahrzeuge ist diese Technik interessant, da hier weniger die Höchstgeschwindigkeit zählt, sondern ein modularer, platzsparender Antrieb mit hoher Steuerpräzision gefragt ist.
Zentrale Motoren mit Achsantrieb
Der Blick in die Zukunft fällt daher ambivalent aus. Trotz wiederkehrender Ankündigungen sind Radnabenmotoren bislang noch kein Massenphänomen. Die großen Autohersteller setzen weiterhin eher auf zentrale Motoren mit Achsantrieb, da diese derzeit in puncto Kosten, Robustheit und Fahrkomfort die Nase vorn haben. Wenn es jedoch gelingt, die Nachteile der Nabenmotoren – etwa das Gewicht an der Radaufhängung oder die Umweltbeständigkeit – zu beheben, könnten sie künftig eine größere Rolle spielen.
Ihre Vorteile sind nämlich bestechend: hohe Effizienz, maximale Flexibilität bei der Kraftverteilung, kompakte Bauweise und völlig neue Möglichkeiten im Fahrzeugdesign. Vielleicht braucht es nur noch einen mutigen Hersteller, der den Schritt in die Serie wagt und ein Antriebskonzept etabliert, das fast so alt ist wie das Automobil selbst.









