Wenn der Motor bei Kälte zickte, nach dem Abstellen nicht mehr starten wollte oder zu viel Sprit soff – dann was früher häufig der Vergaser schuld. In älteren Fahrzeugen übernimmt er auch heute noch die zentrale Aufgabe der Gemischbildung. Und braucht viel Aufmerksamkeit und Pflege. Kein Wunder, dass moderne Autos längst auf eine andere Technik setzen.
Der Vergaser sorgt dafür, dass Luft und Benzin im richtigen Verhältnis gemixt werden, bevor das Gemisch in den Zylinder gelangt. Dort wird es verdichtet und gezündet – der Kern jedes Verbrennungsvorgangs. Der Begriff "Vergaser" leitet sich vom physikalischen Vorgang des "Vergasens" ab: Flüssiger Kraftstoff wird durch Unterdruck in feine Tröpfchen zerstäubt und mit Luft verwirbelt, sodass ein zündfähiges Luft-Kraftstoff-Gemisch entsteht. Das Prinzip ist dabei simpel: Die einströmende Luft erzeugt in einer verengten Stelle des Ansaugkanals (dem sogenannten Venturi-Rohr) einen Unterdruck. Dieser saugt Benzin aus einer kleinen Düse, das sich dann mit der Luft mischt. Je nachdem, wie stark das Gaspedal gedrückt wird, öffnet sich eine Drosselklappe, wodurch mehr Luft und damit auch mehr Kraftstoff angesogen wird – der Motor liefert mehr Leistung.
Ursprünge der Technik: Bis ins 19. Jahrhundert
Die Ursprünge der Technik reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück. Bereits um 1885 entwickelten Erfinder wie Wilhelm Maybach erste funktionsfähige Versionen für die frühen Daimler-Motoren. Über Jahrzehnte hinweg war der Vergaser die Standardlösung beim Ottomotor. Mit zunehmender Verbreitung des Automobils entstanden unzählige Varianten: Fallstrom-, Gleichdruck- oder Registervergaser, oft mechanisch komplex, feinjustiert und empfindlich gegenüber Verschmutzungen oder Temperaturschwankungen. In der Werkstatt galt der Vergaser als sensible Komponente, deren Reinigung und Einstellung Spezialwissen erforderte.
Technik verstehen - Vom Elektroantrieb zum Scheinwerfer
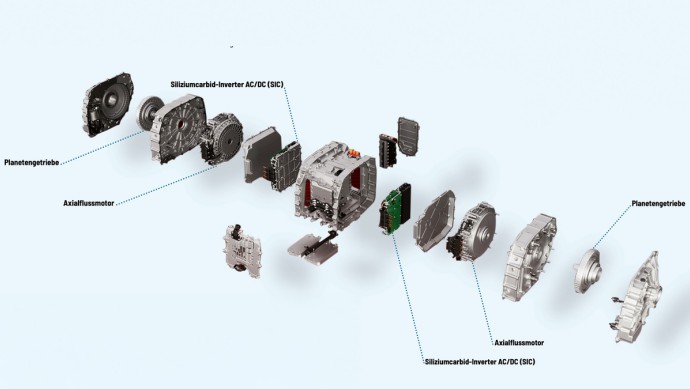 Bildergalerie
Bildergalerie
Doch mit steigenden Ansprüchen an Effizienz, Leistung und vor allem Umweltverträglichkeit geriet der Vergaser zunehmend unter Druck. Ab den 1980er-Jahren begann sich die elektronische Benzineinspritzung durchzusetzen. Sie misst mit Sensoren präzise, wie viel Luft in den Motor strömt, und spritzt den Kraftstoff elektronisch geregelt direkt oder indirekt ein. Das spart Benzin, reduziert Abgase und macht das Motormanagement anpassungsfähiger. Der Vergaser, rein mechanisch und auf physikalische Effekte angewiesen, konnte hier nicht mithalten. In Europa verschwand er mit Einführung der Abgasnorm Euro 1 in den 1990er-Jahren weitgehend aus der Serienproduktion.
Heute findet man Vergaser fast nur noch in Oldtimern, Motorrädern oder Kleinmotoren wie Rasenmähern. Dort punkten sie weiterhin mit einfacher Bauweise, geringem Gewicht und Unabhängigkeit von elektronischer Steuerung – ein Vorteil in abgelegenen Regionen oder bei robusten Maschinen ohne Bordelektronik.








