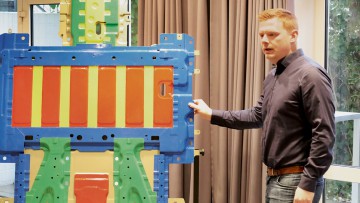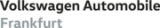Ein E-Auto kann Strom nicht nur selbst verfahren, sondern ihn auch spenden. Etwa an E-Bikes, Werkzeuge, Open-Air-Soundsysteme oder gleich ans Netz. Die dahinterstehende Technik nennt man Vehicle-to-X (V2X), wobei das X für alles oben Genannte und noch viel mehr stehen kann. Das ist im besten Fall nicht nur praktisch, sondern künftig auch ein Mittel zur Netzstabilisierung und ein neues Ertragsmodell für Fahrzeughalter.
Beim herkömmlichen Ladevorgang wird Strom aus dem Netz in die Batterie eines E Autos gespeist. Beim bidirektionalen Laden funktioniert dieser Prozess auch in Gegenrichtung. Möglich wird das durch spezielle Wechselrichter, intelligente Steuerungen und eine geeignete Ladeinfrastruktur. Eine zentrale Voraussetzung: Das Auto, die Wallbox und das Haus- oder Stromnetz müssen diese Funktion technisch unterstützen und miteinander kommunizieren können.
Auch interessant:
- Wie funktioniert eigentlich: Variable Ventilsteuerung
- Wie funktioniert eigentlich: Die Zapfpistole
- Wie funktioniert eigentlich: Die Zapfpistole
- Wie funktioniert eigentlich: Die Hupe
Die nötige Technik ist bereits verfügbar, aber bislang nur in wenigen E-Fahrzeugen– wenn auch mit steigender Tendenz. Auch Ladegeräte und Wallboxen mit bidirektionaler Funktion stehen bereit. Wichtig ist dabei der Kommunikationsstandard (ISO 15118 20), der regelt, wie Auto und Ladesäule Informationen austauschen – etwa, wann geladen oder entladen wird und mit welchen Leistungsgrenzen.
Auto als Haus-Akku
Bidirektionales Laden lässt sich in mehreren Varianten nutzen. Bei der „Vehicle to Home“ (V2H) genannten Anwendung speist das Auto Strom direkt ins Hausnetz, etwa wenn abends der Strombedarf steigt und Solarstrom nicht mehr zur Verfügung steht. In Verbindung mit PV Anlagen können Haushalte damit ihren Eigenverbrauch erhöhen und Kosten senken. Das E-Auto dient quasi als zusätzliche Speicher-Batterie. Bei Vehicle to Grid (V2G) geht der Strom sogar zurück ins öffentliche Netz – ein Modell für zukünftige Strommärkte, in denen tausende Fahrzeuge kurzfristig als Zwischenspeicher einspringen, um Lastspitzen zu glätten oder Netzengpässe zu vermeiden. Daneben gibt es das Vehicle to Load (V2L), bei dem das Auto als Stromquelle für elektrische Geräte dient –etwa auf Baustellen, Campingplätzen oder bei Stromausfällen. Diese Variante wird mittlerweile häufiger von Herstellern angeboten, denn sie erfordert keinen Netzeingriff oder zusätzliche Technik und ist daher für jeden Nutzer leicht umsetzbar.
Technik verstehen - Vom Elektroantrieb zum Scheinwerfer
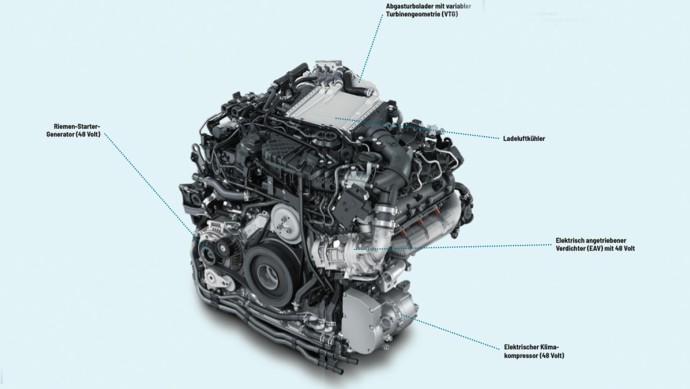 Bildergalerie
Bildergalerie
Das Potenzial von bidirektionalem Laden ist groß: Es könnte helfen, erneuerbare Energien besser ins Netz zu integrieren, die Netzstabilität erhöhen und den Stromverbrauch im Haus optimieren. Fahrzeughalter könnten durch cleveres Laden ihre Energiekosten senken oder sogar Einnahmen erzielen. Studien zeigen, dass ein Fahrzeug im Jahr mehrere hundert Euro durch Einspeisung erwirtschaften könnte – vorausgesetzt, entsprechende Vergütungsmodelle und Marktbedingungen existieren. Außerdem muss die Nutzung passen – wer sein Auto nur zu bestimmten Zeiten laden kann, profitiert unter Umständen gar nicht von Niedrigpreisphasen.
Und es gibt weitere Einschränkungen: Die Batteriealterung durch häufiges Be- und Entladen ist ein Thema, wenn auch Hersteller inzwischen von geringerem Einfluss ausgehen. Rechtlich ist die Einspeisung ins öffentliche Netz in Deutschland zudem bislang kompliziert, etwa wegen fehlender Regelungen zur Vergütung oder Netzverträglichkeit. Zudem braucht es geeignete Tarife, Netzzugänge und digitale Steuerungssysteme, die die komplexen Energieflüsse im Alltag ermöglichen. Das alles ist bereits verfügbar, aber häufig noch sehr teuer. Das dürfte sich in den kommenden Jahren jedoch zunehmend ändern. Wer sich jetzt ein neues E-Auto kauft, sollte daher auf Bidirektionalität nicht verzichten.