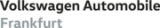Kaum ein technisches Detail im Auto ist so unscheinbar und zugleich so obligatorisch und universell wie die Hupe. Ob Kleinwagen oder Lkw, Oldtimer oder Elektroauto: Der kurze, durchdringende Signalton gehört bei allen zur Grundausstattung.
Ihre durchschlagende Karriere hat weit vor dem Siegeszug des Automobils begonnen. Bereits in der Kutschenzeit setzten Fuhrleute auf akustische Signale, um Fußgänger oder andere Fahrzeuge zu warnen. Mit den ersten Automobilen um 1900 wuchs der Bedarf an wirksamen Warneinrichtungen. Autos waren schneller als Pferdekutschen, aber noch leise genug, sodass sie für andere Verkehrsteilnehmer überraschend auftauchten.
Die ersten an Automobilen montierten „Hupen” waren mechanische Gummiballhörner, die ähnlich wie die heute an einigen Kinderfahrrädern angebrachten Hörner funktionieren. Durch Drücken eines Gummiballs wird Luft durch eine Metallzunge gedrückt, die das charakteristische „Honk“-Geräusch erzeugt. Zwischen 1900 und 1910 waren diese Ballhupen auch an Autos üblich.
1910: Elektromechanische Hupen
Parallel dazu entwickelten sich die ersten elektrischen Systeme. Um 1910 kamen elektromechanische Hupen auf den Markt, die sich schnell als Standard etablierten. Sie hatten den Vorteil, dass sie robust waren und sich leicht bedienen ließen. Großen Erfolg hatte die Klaxon-Hupe. Bei dieser Variante sitzt im Inneren ein kleiner Elektromotor, der eine zahnradbesetzte Scheibe rotieren lässt. Diese Scheibe versetzt wiederum eine Metallmembran in Schwingungen. Der Motor dreht mit hoher Drehzahl, wodurch die Membran einen kräftigen, vibrierenden Ton erzeugt. Abhängig von der Motordrehzahl klang dieser eher tief, heiser und „wimmernd“. Ein Trichterhorn verstärkte diesen Ton, sodass das berühmte „Ahooga“ ertönte. Große Verbreitung fand dieser Hupentyp mit dem Ford Model T und dem Ford Model A, die das Straßenbild in den USA zwischen 1910 und 1930 prägten.
1920: Pneumatischen Hupen
Ab den 1920er-Jahren etablierten sich auch die ersten pneumatischen Hupen. Sie wurden jedoch eher bei Nutzfahrzeugen, Lkws, Bussen und Zügen eingesetzt, da sie kräftiger waren und weithin zu hören waren. In normalen Pkw waren sie zunächst unüblich, da eine Druckluftquelle fehlte. Mit den aufkommenden Luftbremssystemen in schweren Lastwagen und Bussen wurden Druckluftfanfaren dort zum Standard.
Für Pkw wurden später kleine, kompakte elektrische Kompressorfanfaren entwickelt. Dabei handelt es sich im Prinzip um Mini-Kompressoren, die über die Autobatterie laufen und ein oder mehrere Fanfarenhörner anblasen. Dieser meist sehr markant klingende Hupentyp war zwischenzeitlich bei sportlichen oder luxuriösen Fahrzeugen beliebt. Später fand diese Technologie auch in der Tuningszene einige Anhänger.
Ab den 1920er-Jahren tauchten die ersten elektromagnetischen Hupen mit Membran auf. Sie waren billiger und kompakter als die frühen Klaxons. Da sie im Gegensatz zu denen auf einen Motor verzichteten, waren sie außerdem weniger verschleißanfällig. Seit Jahrzehnten gilt dieser Hupentyp als Standard. Fast jedes moderne Autos verfügt über eine solche 12-V-Elektromembranhupe.
12-V-Elektromembranhupe
Bei diesem Hupentyp sitzt im Inneren eine Spule, die bei Stromfluss ein Magnetfeld erzeugt. Dieses zieht einen federbelasteten Anker (ein Metallplättchen) an. Der Anker ist mit einem Kontakt verbunden, der den Stromkreis öffnet und schließt. Wenn der Anker angezogen wird, unterbricht er den Strom, das Magnetfeld bricht zusammen und die Feder zieht den Anker zurück, sodass der Stromkreis wieder geschlossen wird. Praktisch flattert der Anker somit sehr schnell hin und her und versetzt eine an ihm befestigte Membran in Schwingung. Dabei wird ein Ton erzeugt, der über ein Horngehäuse verstärkt und nach außen geleitet wird. Dabei entsteht der typische Ton, den wir lautmalerisch als „Tröööt” oder „Tuut” bezeichnen.
Technik verstehen - Vom Elektroantrieb zum Scheinwerfer
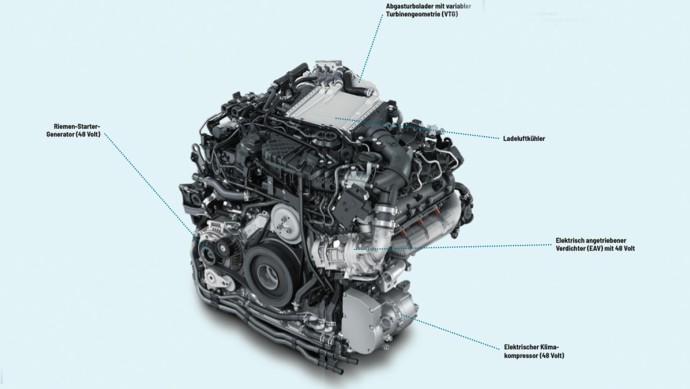 Bildergalerie
Bildergalerie
Längst ist die Hupe in nahezu allen Ländern für Pkw gesetzlich vorgeschrieben. Ihre Hauptaufgabe ist unverändert: Sie soll Aufmerksamkeit erzeugen, um Gefahrensituationen zu vermeiden. Dass sie im Alltag oft auch für Ungeduld oder Frust missbräuchlich eingesetzt wird, gehört zu ihrer ambivalenten Rolle im Straßenverkehr.
Parallel zur Hupe hat sich in Elektroautos mittlerweile eine weiteres akustisches Warnsystem etabliert. Da diese Fahrzeuge bei niedriger Geschwindigkeit kaum Geräusche erzeugen, werden spezielle Laute über Lautsprecher erzeugt. Diese meist recht dezente Warntonfunktion ist in der EU und den USA rechtlich vorgeschrieben.
Auch interessant:
- Wie funktioniert eigentlich: Die Scheibenheizung
- Wie funktioniert eigentlich: Die Lichtmaschine
- Wie funktioniert eigentlich: Die Zapfpistole
Mit dem Aufkommen automatisierter Fahrfunktionen und autonom fahrender Fahrzeuge könnte man meinen, dass die Hupe an Bedeutung verliert. Wenn Autos selbstständig fahren, Abstand halten und kommunizieren können, wäre ein akustisches Warnsignal vielleicht überflüssig. Andererseits wird es wahrscheinlich Mischsituationen geben: autonome und manuell gesteuerte Fahrzeuge, Fußgänger, Radfahrer – für all diese Verkehrsteilnehmer werden auch künftig akustische Warntöne wichtig bleiben. Denkbar wäre, dass die Hupe in Zukunft „smarter” wird, beispielsweise indem sie in Wohngebieten leiser ist oder gezielter in Richtung einer erkannten Gefahr abstrahlt. Ein vollständiges „Aus“ für die Hupe erscheint deshalb als unwahrscheinlich.