Ohne Zweimassenschwungrad wäre das Autofahren mit dem Verbrenner eine ruckelige und unrunde Angelegenheit. Die Weiterentwicklung des einfachen Schwungrads dämpft Schwingungen und schützt das Getriebe vor übermäßiger Belastung. Seine Karriere verdankt es nicht zuletzt dem Trend zum sparsamen Fahren.
Im Inneren eines Verbrennungsmotors entstehen durch die Verbrennungsvorgänge sogenannte Torsions- oder Drehschwingungen, weil der Motor seine Kraft nicht gleichmäßig, sondern in Impulsen abgibt – Zylinder für Zylinder. Besonders bei niedrigeren Drehzahlen oder unter Last können diese Schwingungen stark werden. Früher übertrug sich dieses Ruckeln fast ungedämpft auf das Getriebe und damit auf den gesamten Antriebsstrang, was zu erhöhter mechanischer Beanspruchung und einem unkomfortablen Fahrverhalten führte.
Zweimassenschwungrad
Hier kommt das Zweimassenschwungrad (ZMS) ins Spiel. Anders als ein einfaches Schwungrad, das nur aus einem massiven Teil besteht, besteht das ZMS aus zwei Massen: einer primären, die mit der Kurbelwelle des Motors verbunden ist, und einer sekundären, die das Drehmoment an das Getriebe weitergibt. Zwischen diesen beiden Massen befindet sich ein komplexes Dämpfersystem mit Federn und gegebenenfalls Reibelementen. Dieses wirkt wie ein Puffer und gleicht die Drehungleichmäßigkeiten aus, bevor sie das Getriebe erreichen.
Das ZMS wurde nicht aus Komfortgründen erfunden, sondern als Antwort auf technische Entwicklungen. Moderne Motoren – vor allem Turbodiesel und aufgeladene Benziner – erzeugen schon bei niedrigen Drehzahlen viel Drehmoment. Gleichzeitig wurde aus Effizienzgründen das Fahren im sogenannten „Niedertourenbereich“ immer populärer. Das bringt zwar Kraftstoffeinsparungen, verstärkt aber die Schwingungsprobleme. Ein herkömmliches Einmassenschwungrad würde bei diesen Anforderungen schnell an seine Grenzen stoßen. Das ZMS sorgt dafür, dass auch bei niedrigen Drehzahlen noch ruckelfrei geschaltet und gefahren werden kann.
Technik verstehen - Vom Elektroantrieb zum Scheinwerfer
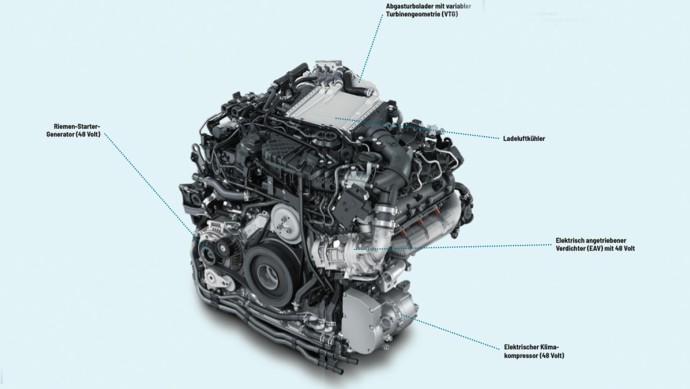 Bildergalerie
Bildergalerie
Die Technik wurde ab den 1990er-Jahren in großem Stil in Serienfahrzeugen verwendet. Besonders bei Dieselmotoren setzte sich das ZMS rasch durch, später auch bei leistungsstarken Benzinern. Inzwischen ist es Standard in vielen Pkw mit Handschaltgetriebe, teilweise auch bei Modellen mit Doppelkupplungsgetrieben.
Der Komfortgewinn hat allerdings seinen Preis. Ein ZMS ist teurer in der Herstellung als ein einfaches Schwungrad und gilt als potenzielle Schwachstelle – vor allem bei unsachgemäßer Fahrweise. Die Dämpferfedern und Reibelemente unterliegen Verschleiß und können mit der Zeit ihre Wirkung verlieren. Dann drohen Rasselgeräusche, Rupfen beim Kuppeln oder sogar ein Totalausfall. Ein Austausch ist aufwendig und teuer, da das ZMS tief im Antriebsstrang sitzt.
Auch interessant:
- Wie funktioniert eigentlich: Das Fernlicht
- Wie funktioniert eigentlich: Die Zapfpistole
- Wie funktioniert eigentlich: Die Hupe
Nicht jedes Auto braucht ein Zweimassenschwungrad. Bei kleineren, schwächeren Motoren reicht oft ein einfaches Schwungrad aus. In Sportwagen hingegen, wo eher Leistung und Direktheit als Komfort gefragt sind, wird aus Gewichts- und Reaktionsgründen manchmal bewusst auf das ZMS verzichtet. Bei Automatikgetrieben ist das Bauteil ebenfalls nicht zwingend nötig, da der Wandler bereits eine ähnliche Dämpfungsfunktion übernimmt.
Mit dem Aufkommen von Elektroautos dürfte das ZMS in Zukunft an Bedeutung verlieren. Elektromotoren liefern ihr Drehmoment gleichmäßig und nahezu vibrationsfrei. Der klassische Antriebsstrang mit Kupplung, Getriebe und Schwungrad wird dort nicht mehr gebraucht.








