Es war einmal die vielleicht coolste Art, ein Auto zu starten: Zündung ein – und zwei Scheinwerferaugen stiegen mit surrendem Geräusch aus der Karosserie hervor. Klappscheinwerfer waren jahrzehntelang eine dieser exotischen Lösungen, die vor allem eines transportierten: Faszination. Sie waren zumeist Sinnbild für technische Raffinesse, aerodynamischen Fortschritt und Sportlichkeit. Doch ihre Ära ist längst vorbei. Fast zumindest.
Klappscheinwerfer, auch "Pop-up Headlights" genannt, sind in der Fahrzeugkarosserie versenkbare Scheinwerfereinheiten, die im ausgeschalteten Zustand bündig mit der Karosserieoberfläche abschließen. Bei Bedarf, etwa bei einsetzender Dunkelheit, werden sie mechanisch oder elektrisch ausgefahren und bringen das Scheinwerferlicht in Position. Die Idee dahinter war zunächst rein funktional: Eine glatte Front verbessert die Aerodynamik, reduziert Windgeräusche und spart somit Kraftstoff. Darüber hinaus ermöglichte die Lösung Designern, extrem flache Fahrzeugfronten und damit schicke Linien zu realisieren, ohne dass diese durch lichttechnische Vorgaben zur Leuchthöhe und Lichtverteilung verunstaltet werden.
Klappscheinwerfer: Showeffekt garantiert
Nebenbei sorgten Klappscheinwerfer für einen Showeffekt, was meist willkommen oder in einigen Fällen sogar explizit gewünscht war. Wer einmal erlebt hat, wie die Scheinwerfer eines Mazda RX-7, einer Corvette C3 oder eines Ferrari 308 synchron aus der Motorhaube hochfahren, spürt auch heute noch unweigerlich, dass es dabei auch um eine Inszenierung von Technik geht.
Auch interessant:
- Wie funktioniert eigentlich: Das Fernlicht
- Wie funktioniert eigentlich: Die Hupe
- Wie funktioniert eigentlich: Die Zapfpistole
Der Ursprung der Klappscheinwerfer reicht in die 1930er-Jahre zurück. Als erstes Serienauto mit Klappscheinwerfern gilt der Cord 810, der 1935 der Öffentlichkeit präsentiert wurde und ab 1936 gebaut wurde. Das technisch und optisch avantgardistische US-Modell setzte Maßstäbe bei der Stromlinienförmigkeit. Dazu trug auch die Scheinwerfer bei, denn diese waren in den vom Karosseriekörper getrennten, vorderen Kotflügeln versteckt. Wurden die Leuchten nicht gebraucht, waren sie unsichtbar. Im Bedarfsfall ließen sie sich über kleine Handkurbeln im Armaturenbrett rein mechanisch in Stellung bringen.
In den 1960er- und 1970er-Jahren erlebte der Klappscheinwerfer seine Blütezeit: Fast alle großen Sportwagenmarken führten Modelle mit "Verschwindibus-Leuchten" ein. Zu den Ikonen gehören Chevrolets Corvette und der Pontiac Firebird, in Europa der Lamborghini Miura und Countach, Ferrari Daytona, Lotus Esprit, Opel GT und Porsche 924/928. Auch japanische Hersteller griffen das Motiv in den 1980er-Jahren begeistert auf, beispielsweise Mazda beim ersten MX-5 und Honda beim Prelude der zweiten und dritten Generation.
Scheinwerfer über Gestänge, Seilzüge oder Hebel betätigt
Bei den frühen mechanischen Varianten wie dem Cord 810 wurden die Scheinwerfer über Gestänge, Seilzüge oder Hebel betätigt, die direkt mit einem Hebel oder einer Kurbel im Innenraum verbunden waren. Der Fahrer übertrug also seine Muskelkraft über eine einfache Kinematik, die meist aus zwei drehbar gelagerten Scharnieren und einer Wippe bestand, auf die Lampeneinheit. Ein Rastmechanismus sorgte dafür, dass die Scheinwerfer im geöffneten oder geschlossenen Zustand sicher arretierten. Ingenieurstechnisch handelte es sich um eine klassische Viergelenkkette, deren Drehpunktgeometrie so ausgelegt war, dass die Bewegung sanft und ruckfrei ablief.
In den 1970er Jahren setzten sich elektro-mechanische Systeme durch, bei denen ein kleiner Gleichstrommotor über ein Schneckengetriebe, eine Exzenterwelle oder ein Gestänge die Bewegung erzeugte. Der Motor drehte nur wenige Umdrehungen; der Rest wurde durch ein Getriebe in eine kontrollierte Schwenkbewegung übersetzt. Ein Endlagenschalter sorgte dafür, dass der Motor sich bei vollständig geöffnetem oder geschlossenem Zustand abschaltete. Bei einem Defekt der elektrischen Komponenten konnte der Mechanismus über eine Notentriegelung manuell betätigt werden.
Technik verstehen - Vom Elektroantrieb zum Scheinwerfer
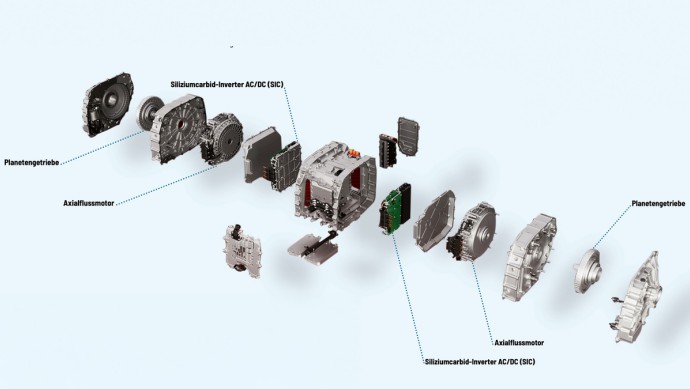 Bildergalerie
Bildergalerie
Unabhängig von ihrem Aufbau waren Klappscheinwerfer nicht ganz unproblematisch: Bewegliche Bauteile erhöhen das Gewicht, erzeugen zusätzliche Fahrgeräusche und können bei Frost versagen oder bei Unfällen hohe Reparaturkosten verursachen. Was allerdings dem Klappscheinwerfer final zu schaffen machte, waren in den 1990er-Jahren eingeführte, neue Vorschriften zu Fußgängerschutz, Beleuchtungshöhe und Crashsicherheit. Ab Mitte der 1990er-Jahre verschwand der Klappscheinwerfer fast vollständig aus dem Automobilbau.
Tchnischer Fortschritt bei der Lichttechnik
Zum Ende der Klappscheinwerfer-Ära trug parallel auch der technische Fortschritt bei der Lichttechnik bei, die Lampeneinheiten kleiner, flacher und effizienter werden ließ. Mit dem Siegeszug von aerodynamisch gut integrierbaren Xenon- und LED-Leuchten erübrigte sich auch die Notwendigkeit, Scheinwerfer mechanisch zu verstecken. Moderne Lichtsysteme erreichen aerodynamisch optimal verpackt und mit winziger Bauform eine enorme Leuchtkraft, ganz ohne bewegliche Karosserieteile.
Und doch: Die Faszination bleibt. Designer spielen noch immer mit der nostalgischen Reminiszenz an eine Ära, in der Autos noch "blinzeln" durften. Ein Beispiel hierfür ist der 2023 vorgestellte Elektrosportwagen Karma Kaveya. Doch ein Comeback der Pop-up-Scheinwerfer im Serienbau ist unwahrscheinlich. Klappscheinwerfer waren ein Kind des technischen Fortschritts und zugleich ein Symbol automobiler Extravaganz. Ihre Ära ist dennoch vorbei. Doch ihr Prinzip, Technik ästhetisch zu inszenieren, hat überlebt. Wenn moderne Scheinwerfer heute aus dunklen oder unsichtbaren Gläsern "erwachen", dann lebt in ihnen ein kleines Stück jener Zeit fort, als Autos noch Augen hatten, die zwinkern konnten.









