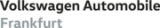Die Idee, einen Verbrennungsmotor mit Hilfsmitteln kurzzeitig auf mehr Leistung zu trimmen, ist so alt wie der Motorsport selbst. Neben Turboladern und Kompressoren zählt die Lachgaseinspritzung zu den klassischen Methoden, um Motoren spontan deutlich mehr Leistung zu entlocken. Diese Lösung ist keineswegs eine Erfindung der Tuning-Szene, auch wenn sie heute vor allem im Rahmen spektakulärer Beschleunigungsduelle auf Dragstrips erlebt werden kann. Erste Versuche mit Distickstoffmonoxid, wie Lachgas in der Chemie korrekt heißt, gab es bereits im Zweiten Weltkrieg. Damals wurde Lachgas in Flugzeugmotoren eingesetzt, um den Triebwerken in großen Höhen zu mehr Sauerstoff und damit zu mehr Leistung zu verhelfen. Später fand das Verfahren vor allem im Rennsport Anwendung, während es im normalen Straßenverkehr in Deutschland aus rechtlichen und sicherheitstechnischen Gründen nicht zulässig ist.
Der Nutzen des Gases ist schnell erklärt: Ein Verbrennungsmotor – egal, ob Diesel- oder Benzinmotor – gewinnt seine Leistung aus der kontrollierten Verbrennung von Kraftstoff und Luft. Je mehr Sauerstoff in den Brennraum gelangt, desto mehr Kraftstoff kann verbrannt werden, was wiederum mit einer höheren Energiefreisetzung einhergeht. Normale Ansaugluft besteht jedoch nur zu etwa 21 Prozent aus Sauerstoff; der Rest sind hauptsächlich Stickstoff und andere Gase, die für die Verbrennung unbrauchbar sind.
Wird nun Lachgas in den Ansaugtrakt eingespritzt, hat dies einen speziellen Effekt im Motor zur Folge: Unter Hitze zerfällt das N₂O in Sauerstoff und Stickstoff. Dem Motor steht plötzlich eine höhere Sauerstoffkonzentration von bis zu 36 Prozent zur Verfügung. Das erlaubt der Einspritzanlage, die Kraftstoffmenge zu erhöhen. Das Ergebnis ist eine deutlich explosivere Verbrennung, die sich in einem spürbaren Leistungszuwachs bemerkbar macht. Je nach Auslegung des Systems lassen sich so auf Knopfdruck Dutzende oder gar Hunderte zusätzliche Pferdestärken erzielen.
Auch interessant:
- Wie funktioniert eigentlich: Das Fernlicht
- Wie funktioniert eigentlich: Die Hupe
- Wie funktioniert eigentlich: Die Zapfpistole
Doch das Verfahren ist nicht nur aufgrund des zusätzlichen Sauerstoffs interessant. Beim Verdampfen wirkt Lachgas außerdem kühlend. Die Ansaugluft wird dadurch dichter, was diesen Effekt weiter verstärkt. Die Kombination aus höherer Sauerstoffkonzentration und kälterer, dichterer Ansaugluft sorgt also für einen doppelten Schub. In der Praxis können selbst vergleichsweise kleine Motoren mit einem NOS-System – so die gängige Abkürzung nach dem Markennamen „Nitrous Oxide Systems” – in Leistungsregionen vorstoßen, die sonst nur mit aufwendigen Motormodifikationen erreichbar wären.
Technik verstehen - Vom Elektroantrieb zum Scheinwerfer
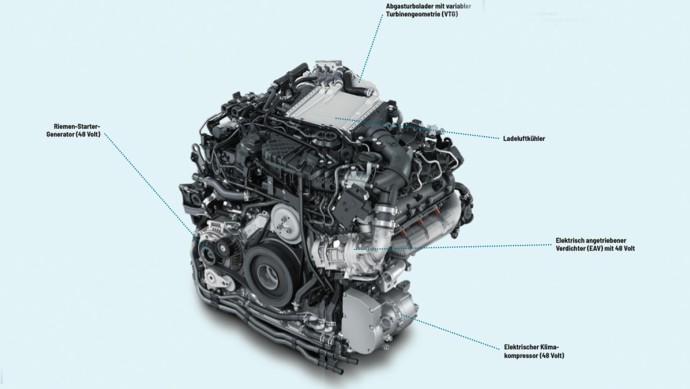 Bildergalerie
Bildergalerie
Die Lachgaseinspritzung ist simpel aufgebaut. Über eine Flasche wird das Gas unter Druck im Fahrzeug mitgeführt, meist in flüssiger Form. Ventile und Leitungen leiten es in den Ansaugtrakt, wo es entweder gemeinsam mit dem Kraftstoff oder separat eingespritzt wird. Die Aktivierung erfolgt zumeist manuell per Schalter oder Knopf, manchmal auch gekoppelt an Vollgasstellungen. Mechanisch ist die Lösung also recht banal, die eigentliche Herausforderung besteht in der richtigen Abstimmung. Ein Motor, der plötzlich mit viel mehr Sauerstoff und Kraftstoff konfrontiert wird, benötigt eine präzise Steuerung, damit die Verbrennung nicht unkontrolliert verläuft.
Nachteile: Mechanischer Stress für Kolben, Pleuel, Kurbelwelle und Zylinder
So faszinierend der kurzfristige Leistungsgewinn auch sein mag, die Nachteile sind nicht zu unterschätzen. Der mechanische Stress für Kolben, Pleuel, Kurbelwelle und Zylinder steigt sprunghaft an. Auch die thermische Belastung erreicht Werte, für die ein Serienmotor nicht ausgelegt ist. Ein falsches Mischungsverhältnis von Luft, Kraftstoff und Lachgas kann zu Klopfverbrennungen oder sogar zu kapitalen Motorschäden führen. Darüber hinaus besteht ein hohes Sicherheitsrisiko, wenn die Gasflaschen nicht sachgerecht eingebaut oder gewartet werden. Ein Leck oder eine unkontrollierte Freisetzung im Fahrzeuginneren kann fatale Folgen haben.
Aus diesen Gründen bleibt die Lachgaseinspritzung ein Nischenphänomen. Sie ist ein Werkzeug für den Motorsport, bei dem es auf Sekundenbruchteile und maximale Leistung über einen kurzen Zeitraum hinweg ankommt. In Drag-Racing-Serien oder beim Show-Tuning hat sie ihren festen Platz, für Rundstreckenfahrzeuge eignet sich diese Lösung hingegen nicht. Im Alltagsverkehr ist sie in Deutschland ebenso wie in vielen anderen Ländern ohnehin strikt untersagt. Neben den Sicherheitsaspekten spielt auch der Umweltschutz eine Rolle, da Distickstoffmonoxid ein starkes Treibhausgas ist.