Wer einmal mit Head-up-Display gefahren ist, versteht den Reiz sofort: Tempo, Navi-Pfeil oder Tempolimit scheinen über der Motorhaube zu schweben, ohne dass man den Blick vom Verkehr abwenden muss. Das Head-up-Display, kurz HUD, will den Blick nach unten auf Tacho oder Zentralbildschirm überflüssig machen – in einer Zeit, in der Autos immer mehr Informationen anzeigen.
Letztlich ist ein HUD ein Projektor mit Umlenkspiegeln. Im Armaturenbrett sitzt eine Bildeinheit, die die Grafiken erzeugt – je nach Hersteller etwa über TFT-LCD oder Micro-LEDs – sowie eine Linsenspiegel-Optik, die daraus ein "virtuelles Bild" macht. Dieses virtuelle Bild wird so berechnet und fokussiert, dass es für die Augen nicht auf der Windschutzscheibe liegt, sondern scheinbar einige Meter vor dem Fahrzeug "in der Luft" steht.
Damit das funktioniert, braucht es eine genau definierte Reflexionsfläche: Entweder dient die Frontscheibe selbst dank spezieller Beschichtung als reflektierender Spiegel oder es gibt eine ausklappbare Zusatzscheibe, einen sogenannten Combiner, der günstig ist, heute aber in Neuwagen kaum mehr zu finden.
Die Inhalte eines klassischen HUDs sind bewusst reduziert. Meist werden Geschwindigkeit, Tempolimit, Hinweise von Assistenzsystemen oder einfache Navigationspfeile eingeblendet. Die Informationen sollen übersichtlich und schnell erfassbar sein – und möglichst wenig ablenken oder das Sichtfeld beeinträchtigen. Moderne HUDs werden immer größer und können dadurch zunehmen mehr Informationen darstellen.
Auf die Spitze getrieben wird dieser Trend bei sogenannten Augmented-Reality-HUDs. Hier werden Informationen nicht nur eingeblendet, sondern räumlich mit der Umgebung verknüpft. Ein Abbiegepfeil scheint dann direkt auf der richtigen Spur zu liegen, ein Warnsymbol markiert scheinbar das vorausfahrende Fahrzeug. Der technische Aufwand ist erheblich: Größere Projektionsflächen, höhere Auflösung und eine exakte Abstimmung mit Kameras, Kartenmaterial und Fahrzeugsensoren sind nötig, damit die Einblendungen zur realen Welt passen und nicht irritieren.
Seine Ursprünge hat Head-up-Display in der Luftfahrt. Kampfflugzeuge nutzten die Technik schon in den 1950er-Jahren, um Piloten Flugdaten direkt ins Sichtfeld einzublenden. In Serienautos tauchte das HUD erstmals Ende der 1980er-Jahre auf, zunächst als einfache Geschwindigkeitsanzeige, die als „schwebender Tacho“ beworben wurden. Lange blieb es ein teures Extra für Oberklassefahrzeuge. Erst mit günstigeren Projektoren und leistungsfähigerer Software hat sich das HUD in der Mittelklasse verbreitet, heute ist es auch schon in kleineren Segmenten zu finden.
Head-up-Displays: Größer, farbiger und informativer
Künftig dürften Head-up-Displays noch größer, farbiger und informativer werden, bis hin zu Konzepten, die sich fast über die gesamte Breite der Windschutzscheibe ziehen. Andererseits wächst das Bewusstsein, dass zu viele Anzeigen die Fahrer eher überfordern als unterstützen. Je mehr Assistenzsysteme warnen und je stärker Autos zu rollenden Apps werden, desto wichtiger wird die Frage, welche Information wirklich in den Blick gehört – und welche besser ganz verschwindet.
Das Head-up-Display ist damit kein Allheilmittel, sondern ein Kompromiss. Richtig eingesetzt kann es helfen, wichtige Informationen dorthin zu legen, wo der Blick ohnehin ist. Ob es am Ende wirklich sicherer macht, hängt weniger von der Technik als von der Frage ab, wie diszipliniert Hersteller mit der kostbaren Fläche im Sichtfeld umgehen.
Technik verstehen - Vom Elektroantrieb zum Scheinwerfer
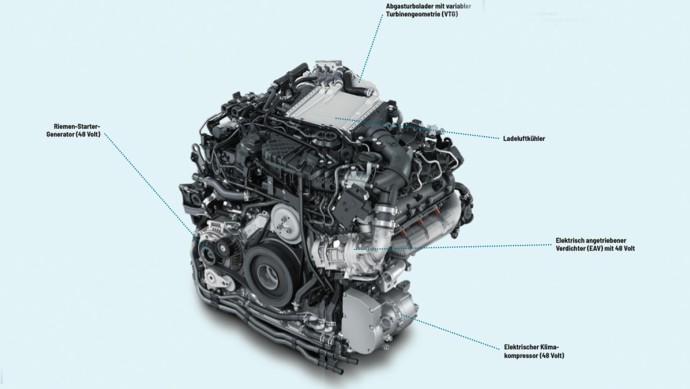 Bildergalerie
Bildergalerie
















