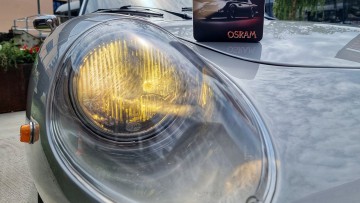Zwischenbericht zur GVO
Ohne Leitplanke?
Die EU-Kommission plant offenbar keine speziell auf die Branche zugeschnittenen Wettbewerbsregeln mehr. Darauf deutet zumindest ihre aktuelle Bilanz zu Funktion und Schwäche der GVO 1400/2002 hin.
Der 28. Mai 2008 könnte einmal in die Geschichtsbücher eingehen: Als Anfang vom Ende der Gruppenfreistellungsverordnung 1400/2002 (GVO) über die Anwendung europäischer Wettbewerbsregeln im Bereich des Vertriebs und der Reparatur von Kfz. Zwei Jahre vor dem Auslaufen dieser branchenspezifischen Regelung hat die EU-Wettbewerbskommission an diesem Tag einen Zwischenbericht veröffentlicht, mit dem die Branche offenbar darauf vorbereitet werden soll, dass sie künftig im Rahmen einer so genannten "Schirm-GVO" denselben Regeln unterliegen könnte wie der Vertrieb anderer Waren und Dienstleistungen.
Zwar habe die GVO 1400/2002 "im Großen und Ganzen positive Auswirkungen" gehabt, doch hätten sich viele der sektorspezifischen Einzelvorschriften "als überflüssig und bisweilen sogar kontraproduktiv erwiesen", resümierte die Kommission. Deshalb sei es im Sinne der Autobesitzer, die Vorschriften zu vereinfachen. Das hört sich zunächst positiv an, nämlich nach Bürokratieabbau. Doch der GVO-Spezialist Dr. Thomas Funke (s. Interview im Kasten) warnt davor, die schützende Leitplanke abzumontieren: "Eine Schirm-GVO schützt den Wettbewerb nicht in derselben Weise wie die Kfz-GVO."
"Flickenteppich" droht
Auch Vertreter aus dem Aftermarket, u.a. die europäischen Dachverbände des Kfz-Gewerbes (CECRA) und des Teilehandels (FIGIEFA), sprachen sich in einer gemeinsamen Erklärung für eine Verlängerung der Kfz-GVO über das Jahr 2010 hinaus aus. Ein "Flickenteppich" aus verschiedensten Regelungen biete keinen geeigneten Rahmen für den Wettbewerb, hieß es. Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) hat aber offenbar keine großen Hoffnungen mehr, dass nach Ablauf der aktuellen GVO neue branchenspezifische Wettbewerbsregeln gelten werden. Für den auf der Mitgliederversammlung Anfang Juni in Berlin wiedergewählten Verbandspräsidenten Robert Rademacher ist dies aber kein Grund, nur Trübsal zu blasen. Da im Servicebereich ein vertraglicher Autorisierungsanspruch bestehen bleibe, könnte für viele Betriebe die Zukunft sogar rosiger als die Gegenwart aussehen. Dies gelte für den Fall, dass sich ein Unternehmer von der "Vertriebsknute" des Herstellers befreien, und nur noch durch die in der Regel lukrativeren Serviceverträge gebunden sei.
Noch ist das letzte Wort aber nicht gesprochen. "Es sei darauf hingewiesen, dass dieser Bericht ... in keiner Weise der endgültigen Entscheidung vorgreift", heißt es am Schluss des Papiers. Bis Ende Juli ist die Branche aufgefordert, Stellungnahmen abzugeben (s.a. Leitartikel). Niko Ganzer
asp hat den GVO-Experten, Rechtsanwalt Dr. Thomas Funke von der Kölner Kanzlei Osborne Clarke, um eine Einschätzung zum Kommissionsbericht gebeten.
Herr Dr. Funke, warum ist die Zukunft der GVO auch für Betriebe ohne Herstellerbindung wichtig?
Die Kfz-GVO regelt auch den Vertrieb von Ersatzteilen im freien Markt. Typische GVO-Themen, wie zum Beispiel die Zulässigkeit einer Bezugsbindung oder die Frage, ob ein Zulieferer seine Produkte als Ersatzteil auch unmittelbar in den Aftermarket liefern darf, betreffen nicht nur Werkstätten, die an einen Fahrzeughersteller gebunden sind. Darüber hinaus geht es natürlich um die Frage, ob der Gesetzgeber einen fairen Rahmen für den Wettbewerb freier Betriebe mit Vertragswerkstätten schafft – zum Beispiel beim Zugang zu technischen Informationen.
Hier hat sich die Situation für freie Werkstätten laut EU-Bericht deutlich verbessert. Stimmen Sie dem zu?
Die Kommission hat durch Verfahren gegen vier Fahrzeughersteller viel zur Herstellung von Chancengleichheit beigetragen, das ist richtig. Aber in der anwaltlichen Praxis beobachten wir weiterhin Probleme in diesem Bereich, nicht nur bei Werkstätten. Auch der Teilegroßhandel oder Hersteller von Mehrmarken-Diagnosegeräten sollen nach der Kfz-GVO Zugang zu technischen Informationen erhalten. Hier werden weitere gerichtliche und kartellbehördliche Verfahren für Klarheit sorgen müssen.
Welche Gefahren sehen Sie, wenn die branchenspezifische GVO tatsächlich einer allgemeineren Regelung weichen würde?
Allgemeinere Normen bieten Raum für Interpretationen, und die damit verbundenen Unsicherheiten könnten zum Nachteil der ohnehin schon schwächeren Marktbeteiligten wirken. Schon heute fehlt es vielfach an einer klaren Ansage, etwa beim Thema Zuliefererbindung durch Werkzeugfinanzierung. Andererseits kann die Anwendung allgemeiner Regeln auch besser auf technische Entwicklungen reagieren – zum Beispiel das Thema Ferndiagnose stellt uns vor neue Fragen. Das funktioniert aber nur, wenn die Kartellbehörden auch in Zukunft das Marktverhalten genau beobachten und Verstöße ahnden. Daran mangelt es schon heute, weil den Kartellbehörden zu wenig Personal zur Verfügung steht – und ich fürchte, dass sich die Behörden künftig noch stärker auf die medienträchtige Verfolgung von Preiskartellen und Fusionskontrolle konzentrieren, statt Wettbewerbsbeschränkungen im Ersatzteilmarkt zu überwachen.
Wird es auch ohne GVO weiter Serviceverträge mit Herstellern geben?
Ja, nach den derzeit geltenden allgemeinen Regeln des Vertriebskartellrechts wäre im Servicebereich eine Autorisierung auch ohne die Kfz-GVO möglich.
Sollten sich freie Werkstätten vermehrt um solche Verträge bemühen?
Ob eine solche Bindung für die Werkstatt Sinn macht, hängt letztlich davon ab, wo sie neben Teilen auch Unterstützung etwa in den Bereichen Diagnose, Teileidentifikation oder Marketing erhält. Dies kann ein Fahrzeughersteller sein, ein Anbieter des freien Marktes, vielleicht aber auch ein Versicherer oder Leasingunternehmen. Die Branche wird hier kreative Lösungen finden, wenn der Gesetzgeber den Rahmen für fairen Wettbewerb gewährleistet.