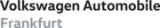Datenbus-Systeme
Datenbus-Systeme gibt es inzwischen in nahezu jedem aktuellen Fahrzeug. Doch Datenbus ist nicht gleich Datenbus. Abhängig vom Verwendungszweck, kommen unterschiedliche Varianten zum Einsatz. Ein Überblick.
Ob sich mehrere Dutzend Steuergeräte, die heute in einem Fahrzeug der oberen Mittel- bis Luxusklasse verbaut sind, auch mit konventionellen Kabelsätzen vernetzen lassen? Theoretisch ja. Mit Kabelsätzen, so dick wie Männer-oberarme, und Steuergerätegehäusen, so groß wie Schuhkartons, weil die Vielzahl der Steckverbindungen keine kleineren Gehäuse zulassen würde. Praktisch also nein. Glücklicherweise haben Zulieferer und Autobauer dieses Problem weit im Vorfeld erkannt und sich bereits seit Mitte der 1980er Jahre mit Alternativen beschäftigt – mit Datenbus-Systemen, die nicht nur Bauraum und Gewicht sparen, son-dern auch große Datenmengen in kurzer Zeit übermitteln und die Diagnosemöglichkeit der Elektrik und Elektronik deutlich erweitern. Die älteste Alternative zur konventionellen Verkabelung ist der CAN-Bus, eine Bosch-Entwicklung, erstmals in Serie eingesetzt in der Mercedes-Benz S-Klasse (Baureihe W140) ab 1991.
CAN, LIN, FlexRay, D2B, MOST etc.
Seither kamen einige weitere Datenbus-Systeme hinzu, so dass heute zunächst zwischen den elektrischen Einleiter- und Zweileiter- sowie den optischen und kabellosen Datenbus-Systemen zu unterscheiden ist. Die weitere Verbreitung Letzterer lässt allerdings noch auf sich warten.
Zu den elektrischen Einleiter- und Zweileiter-Systemen zählen CAN (Controller Area Network) und LIN (Local Interconnect Network). Bei ByteFlight, D2B (Do-mestic Digital Bus) und MOST (Media Oriented System Transport) handelt es sich um optische Systeme. FlexRay und IEEE 1394 (alternative Bezeichnungen: FireWire und i.Link) lassen beide Mög-lichkeiten zu. Künftige kabellose Datenbus-Systeme nutzen den Bluetooth-Standard. Welches Datenbus-System in wel-chem Fahrzeug und zu welchem Zweck zum Einsatz kommt, hängt von mehreren Faktoren ab: Übertragungsrate, elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und nicht zuletzt Kosten-Nutzen-Verhältnis.
So hatten in der Vergangenheit elektrische Einleiter- und Zweileiter-Datenbus-Systeme mitunter EMV-Probleme. Der Begriff des Datenbus-Weckens wurde geprägt, als sich über Nacht abgestellte Fahrzeuge am Morgen nicht mehr starten ließen und man den Batteriekapazität zehrenden Datenbus als Ursache dafür identifizierte: Andere Fahrzeuge, die am abgestellten Fahrzeug vorbeifuhren, oder in der Nähe befindliche Elektroanlagen erzeugten elektromagnetische Felder, die den Datenbus aus dem Sleep-Modus "weckten" und hochfahren ließen. Inzwischen sollen diese Probleme gelöst sein, sagt die Automobilindustrie.
Beispiel CAN-Datenbus
Dass Datenbus-Systeme bei allen genannten Vorteilen den Aufbau eines elektrischen Bordnetzes nicht vereinfachen, sondern verkomplizieren, zeigt das Beispiel CAN: Ein CAN-Bus dient hauptsächlich zur Da-tenübertragung zwischen Steuergeräten und besteht neben dem eigentlichen Ver-bindungsmedium, hier eine Zwei-Draht-Kupfer-Leitung (CAN high, CAN low) samt Abschlusswiderständen, aus mindestens zwei so genannten Knoten. Das sind in diesem Fall Steuergeräte mit separater Spannungsversorgung und zusätzlichen Bauteilen, konkret Controller und Transceiver. Letzterer fungiert als Sender und Empfänger der Datensignale, während der Controller Daten zum Senden aufbereitet und gesendete, für das betreffende Steuergerät relevante Daten herausfiltert.
Eine solche Datensendung besteht aus mehreren Teilen (Feldern), deren Abfolge (Protokoll) standardisiert ist. Das Anfangsfeld (1 Bit) steht am Beginn, es informiert alle angeschlossenen Knoten über die neue Datensendung. Es folgt das Statusfeld mit dem Identifier (11 Bit), der die Priorität einstuft. Auf ein unbenutztes Bit folgt das Kontrollfeld (6 Bit). Gemeinsam mit dem Sicherungs- (16 Bit) und Bestätigungsfeld (2 Bit) sorgt es für die Sicherung und Be-stätigung der Übertragung. Ggf. wird die Datensendung mehrfach wiederholt. Das Datenfeld, zwischen Kontroll- und Sicherungsfeld positioniert und maximal 64 Bit groß, enthält den eigentlichen Inhalt der Datensendung. Abgeschlossen wird die Datensendung mit dem Endefeld (7 Bit). Damit ist der Datenbus für die Sendung der nächsten Botschaft frei.
Diagnose: Zweileiter-Datenbus
Im Werkstattalltag haben sich Datenbus-Systeme, zumindest was die Diagnose betrifft, als relativ unproblematisch er-wiesen. Einerseits tragen sie zur Vertiefung der Diagnosemöglichkeiten bei, andererseits lassen sie sich selbst diagnostizieren. Bei einem elektrischen Zweileiter-Datenbus wie dem CAN-C (Highspeed-CAN) kann das beispielsweise per Oszilloskop geschehen, indem man die Spannungs-pegel der beiden Leitungen (CAN high und CAN low) vergleicht. Werden auf dem Oszilloskop-Bildschirm die beiden Kanäle übereinander dargestellt, müssen Spannungsänderungen zwar zeitgleich, jedoch in unterschiedlichen Richtungen (spiegelbildlich) verlaufen. Als mögliche Datenbusinterne Fehlerquellen kommen
Unterbrechung einer Leitung (erkennbar über die Eigendiagnose),
Kurzschluss einer Leitung nach Masse (im Oszilloskop-Bild fehlt ein Pegel),
Kurzschluss einer Leitung nach Plus (im Oszilloskop-Bild liegt ein Pegel auf Bordspannungsniveau) und
Kurzschluss zwischen den Leitungen (kein spiegelbildlicher, sondern paralleler Verlauf beider Pegel) in Frage.
Handelt es sich um einen optischen Datenbus wie dem meist in Ringstruktur ausgeführten MOST und zeigt dieser erhöhte Dämpfung, können ein Knick oder Bruch des Lichtwellenleiters, ein beschädigter Mantel, ein Luftspalt zwischen Stecker und Steuergerät, verschmutzte oder verkratzte Stirnflächen oder ein zu stark gequetschter Crimp ursächlich sein. Dann kommt eine so genannte Ringbruchdiagnose in Frage, was inzwischen auch mit markenüber-greifenden Diagnosegeräten möglich sein sollte. Nach Anschluss einer speziellen Ringbruchdiagnoseleitung und Start der Ringbruchdiagnose im Diagnosegerät, schalten alle Knoten (Steuergeräte) ihre im Fibre Optical Transceiver (FOT) eingebaute LED ein und prüfen gleichzeitig, ob das Lichtsignal von anderen Busteilnehmern an der Fotodiode im FOT ankommt. Das Diagnosegerät listet anschließend alle an den MOST angeschlossenen Steuergeräte und deren Status auf, woran ggf. die Position der Schadenstelle erkennbar ist.
Integration von Zubehör
Auch die Integration von Zubehör erwies sich nicht als so schwierig wie zunächst von einigen Marktteilnehmern befürchtet. Längst existieren zahlreiche universelle oder spezifische Adapter, beispielsweise vom Hersteller AIV der MICKI genannte Adapter zur Bedienung einer Freisprecheinrichtung von Funkwerk Dabendorf (FwD) über die Tasten eines Multifunktionslenkrads. Zudem filtert der Adapter das Signal Zündung an/aus aus dem Datenbus. Noch mehr Informationen, nämlich Motordrehzahl, Fahrgeschwindigkeit und Kraftstoffverbrauch, zieht der CAN-Bus-Adapter für die so genannte Fleetbox der FwD-Tochter EuroTelematik aus einem Datenbus. Allerdings konzentriert sich das Unternehmen auf Lkw, so dass die Bereiche Pkw und – ebenfalls eine interessante Zubehör-Zielgruppe – Transporter außen vor bleiben. Die Integration von markenspezifischem Zubehör stellt von Anfang an keinerlei Hürde dar.
Peter Diehl
Multimedia
Aufrüstung
Multimedia-Spezialist Alpine Electronics mit deutschem Sitz in München (www.alpine.de) hat ein Aufrüstsystem speziell für bereits mit Multimediasystemen ausgestattete Gebrauchtfahrzeuge entwickelt. Erfahrungsgemäß sei die "Halbwertzeit" (O-Ton) derartiger Sys-teme relativ kurz, weshalb mit der Nachrüstung des Perfect FIT ge-nannten Systems nicht nur den Haltern, sondern auch dem Ge-brauchtwagenhandel geholfen werde. Das Kürzel FIT steht für Factory Integration Technology, die die Anbindung neuer Navigations- und Unterhaltungssysteme (iPod, DVD-Player, DVB-Tuner etc.) oder beispielsweise einer Rückfahrkamera ermög-licht, und zwar unter Nutzung des vorhandenen Bildschirms, also ohne Ver-änderung der originalen Optik des Armaturenbretts. "Sogar ein Upgrade des serienmäßigen Soundsystems ist umsetzbar", so die Mitteilung von Alpine Electronics im Originalton.
Die wichtigsten Datenbus-Systeme im Überblick
Bezeichnung
Verwendungszweck
Ausführung
Übertragungsrate
Besonderheit
CAN (Controller Area Network)
Vernetzung von Steuergeräten
Zwei-Draht-Kupfer-Leitung mit verdrillten oder unverdrillten Adern, Ein-Draht-Kupfer-Leitung (zwecks Kostensenkung)
5 bis 125 kBit/S (CAN-B),125 kBit/s bis 1MBit/s (CAN-C)
Entwicklung von Bosch (1980er Jahre), erster in Serie eingesetzter Datenbus (1991 im W140), Unterteilung in Lowspeed-CAN (CAN-B),Highspeed-CAN (CAN-C), zeit- statt ereignis-gesteuerter CAN (Time Triggered CAN, TTCAN)und Ein-Draht-Leitung (Single Wire CAN)
LIN(Local Interconnect Network)
Kommunikation mit aktiven Sensoren und Aktoren, lokale Vernetzung mechatronischer Komponenten (Türelektrik, Klimaanlage, elektr. Sitzverstellung etc.)
Ein-Draht-Kupfer-Leitung(nicht abgeschirmt)
bis 20 kbit/s
Entwicklung des LIN-Konsortiums (Audi, BMW, Daimler, Volvo, VW, Volcano und Motorola), einfach und billig, somit Alternative zum CAN-B
ByteFlight
Sicherheitssysteme
Polymer-Fasern (optischer Bus)
bis 10 MBit/s
Entwicklung von BMW in Kooperation mit Motorola, Elmos und Infineon, inzwischen ersetzt durch TTCAN oder FlexRay
FlexRay
Fahrerassistenzsysteme,x-by-wire-Systeme
Kupferkabel oder Lichtleiter
bis 10 MBit/s
Entwicklung des FlexRay-Konsortiums(gegründet 2000 von BMW, Daimler, Motorola und Philips, später kamen u. a. Bosch, GM und VW hinzu), Weiterentwicklung des ByteFly-Datenbusses
D2B optical (Domestic Data Bus)
Infotainmentsystem-Vernetzung
Polymer-Fasern (optischer Bus)
5,6 MBit/s
Entwicklungsstart: 1995, somit erster in Serie eingesetzter optischer Datenbus
MOST (Media Oriented Systems Transport)
Vernetzung von Infotainmentsys-temen, verwendet in vielen Bau-reihen der Mittel- und Oberklasse
Polymer-Fasern (optischer Bus)
24,8 MBit/s (MOST 25),50 MBit/s (MOST 50),150 MBit/s (MOST 150)
Entwicklung der MOST Corporation (gegründet 1998 von verschiedenen Automobilherstellern und Zulieferern)
IEEE 1394
Anbindung mobiler Geräte an das Fahrzeug (plug & play)
mehradriges Kupfer-, Polymer- oder Glasfaserkabel (abhängig von der Anwendung)
100, 200, 400 oder 800 MBit/s
Entwicklung von Apple (1995), zunächst für Computer und Haushaltselektronik bestimmt, alternative Bezeichnungen: FireWire (Apple) oder i.Link (Sony)