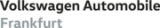Es gibt unterschiedliche Reifentypen, die für den jeweiligen Einsatzzweck konzipiert sind. Im Pkw-Bereich kann man grundsätzlich zwischen drei Typen unterscheiden: Sommerreifen, Winterreifen und Ganzjahresreifen.
- Sommerreifen sind wie der Name schon sagt für den Einsatz im Sommer und wärmeren Jahreszeiten geeignet. Die Gummimischung von Sommerreifen sorgt dafür, dass Autos gut auf trockenen und nassen Straßen fahren können.
Im Volksmund spricht man vom Einsatz von Ostern bis Oktober, obwohl das nur eine grobe Orientierung ist, da es auch an Ostern schneien kann. Man sollte diese Reifen eher bei dauerhaften hohen Temperaturen über sieben Grad Celsius einsetzen, da sie hier am besten funktionieren. Als Sonderform der Sommerreifen gibt es noch so genannte "Ultra-High-Performance"-Reifen (UHP), die es oft nur in den höheren Reifengrößen gibt und die auf maximale Performance für sportliche Autos ausgelegt sind.
- Winterreifen sind wie der Name sagt für den Einsatz im Winter geeignet, sollten aber, wenn man die O-bis-O-Regel beachtet, auch schon im Herbst und auch im Frühling zum Einsatz kommen, wenn die Temperaturen dauerhaft unter sieben Grad liegen. Winterreifen funktionieren aufgrund ihres Schneeprofils und ihrer weicheren Gummimischung mit höherem Kautschukanteil hervorragend, wenn es draußen glatt und kalt ist. Dort spielen sie ihre Karten aus, indem sie auf Schnee, Eis und auch nasser Fahrbahn einen guten Grip bieten. Winterreifen lassen sich am Schneeflockensymbol beziehungsweise dem 3-Peek-Mountain-Snowflake-Symbol erkennen, das auf neueren Reifen zu finden ist.
- Ganzjahresreifen sind eine amerikanische Erfindung (Goodyear ist ein großer Verfechter dieser Technologie) und wie der Name schon suggeriert, eine Mischung aus Sommer- und Winterreifen. Das heißt, sie können das ganze Jahr über gefahren werden. Allerdings bieten Ganzjahresreifen nicht dieselben Vorteile und eine Spezialisierung wie Sommer- oder Winterreifen, sondern sie sind immer ein Kompromiss. Allerdings sind sie über die Jahre deutlich verbessert worden. Und sie liegen im Trend, wie die Verkaufszahlen beweisen. Gerade für das Zweitauto für die Stadt oder in Regionen mit gemäßigten Temperaturen sind sie inzwischen eine ernstzunehmende Alternative zur saisonalen Bereifung. Weiterer Vorteil: Der halbjährliche Reifenwechsel entfällt für den Autofahrer. Dennoch sollten auch Ganzjahresreifen regelmäßig überprüft und achsweise getauscht werden, wenn das Profil ungleichmäßig abgefahren ist. Ganzjahresreifen sind im Regelfall aufgrund der weicheren Gummimischung auch schneller abgefahren. Und besonders hohe Temperaturen im Hochsommer behagen ihnen nicht, sie neigen dann zum Schmieren und der Bremsweg verlängert sich merklich.
Neben den genannten Reifentypen gibt es noch weitere Varianten der Pneus. So setzen einige Hersteller vermehrt auf sogenannte "E-Auto"-Reifen und bewerben diese damit, dass sie aufgrund des niedrigen Rollwiderstands die Reichweite von E-Autos erhöhen. Das kann im niedrigen Prozentsatz der Fall sein, allerdings gilt das ebenso für Verbrennerfahrzeuge. Man sollte deshalb eher von Energiesparreifen sprechen. Im Regelfall sind diese Reifen etwas teurer als konventionelle Pneus.
Reifenfunktionen
- Kraftübertragung
Reifen beeinflussen maßgeblich das Fahrverhalten, die Sicherheit und den Komfort eines Fahrzeugs. Die Reifenaufstandsfläche muss vor allem die Gewichtskraft des Autos aufnehmen und Längskräfte und Seitenkräfte übertragen. Längskräfte entstehen in Laufrichtung beim Beschleunigen oder Bremsen. Seitenkräfte treten auf, wenn man in Kurven und dabei quer zur Fahrtrichtung fährt.
- Sicher unter allen Bedingungen
Der Reifen muss ein genaues Lenken ermöglichen und Fahrbahnstöße durch Abfedern und Dämpfen reduzieren. Ein guter Reifen bietet zudem eine gute Leistung sowohl bei nassen als auch trockenen Witterungsbedingungen, besonders beim Bremsen und beim Handling. Beim Bremsen äußert sich ein schlechter Reifen durch einen deutlich längeren Bremsweg, was im Falle einer Vollbremsung darüber entscheiden kann, ob ein Unfall passiert oder nicht.
- Rollwiderstand
Ebenfalls immer wichtiger wird der Rollwiderstand eines Reifens. Das ist wichtig, damit Elektroautos eine hohe Reichweite erzielen können. Aber auch Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren profitieren von einem niedrigen Rollwiderstand.
- Haltbarkeit
Der Abrieb des Reifens und damit seine Haltbarkeit, werden durch schnelles Fahren und auch den Asphalt beeinflusst. Durch neue Gummimischungen wird weniger Abrieb und eine längere Haltbarkeit des Reifens erreicht. Die Hersteller müssen zudem die neue Euro-7-Norm berücksichtigen, die künftig auch den Abrieb der Reifen berücksichtigt.
- Lautstärke
Hierbei kann zwischen dem externen Geräusch beim Vorbeifahren des Autos und dem Geräusch unterschieden werden, das der Fahrer während der Fahrt warnimmt. Ersteres wird bei der Reifenentwicklung in Praxistests nach einer speziellen Norm ermittelt und ist auch Teil des Reifenlabels. Geräusche im Inneren des Autos werden auf unterschiedlichen Untergründen wie Schotter, Pflastersteinen oder schlechtem Asphalt ermittelt.

Bestandteile des Reifens
In einem modernen Pkw-Reifen stecken zahlreiche verschiedene Stoffe, deren genaue Rezeptur und Zusammensetzung die Reifenhersteller wie einen Schatz hüten. Grundlegend kommen beim Reifenbau folgende Zutaten zum Einsatz:
- Kautschuk, sowohl aus der Natur als auch aus der Industrie
- Füllstoffe (zum Beispiel Ruß, Silika, Kohlenstoff)
- Festigkeitsträger (aus Stahl, Polyester, Rayon oder Nylon)
- Weichmacher (Öle und Harze)
- Chemikalien für die Vulkanisation (Schwefel, Zinkoxid und andere)
- Schutz vor Alterung und andere Chemikalien
Die Bestandteile können sich je nach Größe und Typ des Reifens (Sommer- oder Winterreifen) unterscheiden. Im Zuge der Nachhaltigkeit werden die Rohstoffe im Reifen zunehmend durch recycelbare oder erneuerbare Rohstoffe ersetzt. So experimentiert Continental beispielsweise mit Kautschuk aus Löwenzahnpflanzen, Bridgestone setzt auf die Guayule-Pflanze.
Doch es gibt noch weitere natürliche Stoffe, die sich in der Reifenproduktion einsetzen lassen. Rayon-Zellulose lässt sich beispielsweise für die Festigkeit der Reifenkarkasse verwenden. Rayon stammt aus Wäldern und Hartholzplantagen und sorgt für eine hohe Festigkeit und Stabilität. Füllstoffe wie Silika lassen sich aus der Asche von Reishülsen gewinnen. Rohölbasierte Füllstoffe lassen sich zudem durch pflanzliche Öle wie beispielsweise Rapsöl und Harze oder aus Reststoffen der Papier- und Holzindustrie ersetzen. Neben dem Einsatz von natürlichen Materialien eignet sich auch der Einsatz von recycelten Materialien zur Reifenherstellung. Continental arbeitet beispielsweise daran, künftig im großen Umfang Industrieruß gewinnen zu können, ein wichtiger Füllstoff in Gummimischungen. Bei der mechanischen Wiederaufbereitung von Reifen lassen sich zudem Gummi, Stahl und Textilcord voneinander trennen. Das Gummi wird anschließend so aufbereitet, dass es wieder als Bestandteil neuer Gummimischungen verwendet werden kann. Auch Kunststoff aus recycelten PET-Flaschen lässt sich verwenden, um daraus ein Polyestergarn zu gewinnen, dass wiederum in den Reifen-Karkassen eingesetzt werden kann. Stahl, der unter anderem als Stahlkern den festen Sitz des Reifens auf der Felge gewährleistet, kann zudem bevorzugt aus recyceltem Material gewonnen werden.
Aufbau des Reifens
Reifen werden in einem komplexen Produktionsprozess hergestellt, der mit der sogenannten Vulkanisation endet. Hier wird der Reifenrohling bei Temperaturen bis zu 200 Grad Celsius unter Druck fertig gebacken.
Folgende Bestandteile hat der Reifen:
- Lauffläche Die Lauffläche beziehungsweise der Laufstreifen sorgen für eine hohe Laufleistung, gute Straßenhaftung und Wasserverdrängung.
- Spulbandagen Spulbandagen tragen dazu bei, hohe Geschwindigkeiten zu erreichen
- Stahlcord-Gürtellagen Stahlcord-Gürtellagen verbessern die Fahrstabilität und den Rollwiderstand des Reifens.
- Textilcord-Einlagen Die Textilcord-Einlagen sorgen dafür, dass der Innendruck gehalten wird und der Reifen in Form bleibt.
- Innenschicht Die Innenschicht sorgt dafür, dass der Reifen luftdicht ist.
- Seitenwand Die Seitenwand schützt vor äußeren Beschädigungen.
- Wulstverstärker Der Wulstverstärker sorgt für mehr Fahrstabilität und präzises Lenkverhalten.
- Kernprofil Das Kernprofil hat vor allem drei Vorteile: Es sorgt für mehr Fahrstabilität, Lenkung und Komfort.
- Stahlkern Der Stahlkern sorgt dafür, dass der Reifen fest auf der Felge sitzt.
Reifenprofil
Das Reifenprofil ist besonders wichtig, weil es die Verbindung zur Fahrbahn ist. Das Profilmuster ist wichtig, um die Griffigkeit und das Handling eines Fahrzeugs zu bestimmen. Jedes Laufflächenprofil besteht aus unterschiedlichen Teilen: Die Profilrippen sind eine Art Profilblöcke, die aneinandergereiht sind. Die Profilrillen sind die Freiräume zwischen den Profilblöcken. Sie müssen bei Nässe möglichst viel Wasser aufnehmen und schnell abtransportieren, um Aquaplaning zu verhindern. Profilblöcke sind die Gummiblöcke, die aus der Lauffläche herausstehen und mit der Fahrbahnoberfläche in Kontakt kommen. Profilblöcke haben feine Einschnitte, die man Profillamellen nennt.
Profilrippen, Profilrillen, Profilblöcke und Profillamellen können in bestimmten Mustern angeordnet werden. So wird die Leistung des Reifens im Hinblick auf Geräusche, Fahrverhalten, Traktion und Verschleiß optimiert. Das gibt den Reifenherstellern die Möglichkeit, Profilmuster zu entwickeln, die auf die speziellen Fahrbedürfnisse abgestimmt sind. Also auf Bremsen bei Nässe, Fahrverhalten auf trockener Fahrbahn, Beständigkeit gegen Aquaplaning und Traktion auf Eis und Schnee. Die Lauffläche, und damit das Profil, verschleißen mit der Zeit. Nach einer Weile wird das Profil immer flacher. Ein Reifen ist abgefahren und nicht mehr verkehrssicher, wenn er weniger als die vorgeschriebene Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimeter aufweist.
Abnutzungsindikatoren, auch „Tread Wear Indicators“ (TWI) genannt, sind Reifenverschleißanzeigen, die in den Reifen selbst integriert sind. Das sind Querstege, die gleichmäßig über den Reifen verteilt sind und sich in den Längsprofilrillen befinden. Wenn sie auf derselben Höhe wie das Restprofil sind, sollte der Reifen ausgetauscht werden. Es gibt aber auch Hersteller, die in das Profil die Restmillimeter mit Symbolen oder eine Zahl versehen, die bei heruntergefahrenem Profil nicht mehr sichtbar sind.