Flach wie ein Pfannkuchen, leicht wie ein Fahrradreifen und dennoch leistungsstark – so beschreibt man gerne den Scheibenläufer- oder Axialflussmotor. In E-Autos, Flugtaxis oder auch in Windkraftanlagen könnte er künftig eine wichtige Rolle spielen.
Im Unterschied zum herkömmlichen Radialflussmotor – dem bislang dominierenden Motortyp in Elektroautos – verlaufen die Magnetfeldlinien parallel zur Drehachse, nicht senkrecht dazu. Der Rotor ist daher keine Welle, sondern eine Scheibe, die zwischen zwei Statoren rotiert. Dieses Layout vergrößert den wirksamen Durchmesser, verkürzt den magnetischen Flusspfad und treibt das Drehmoment regelrecht in die Höhe - eine Eigenschaft, die beim begrenzten Bauraum im E-Auto von großem Vorteil ist. Darüber hinaus ermöglicht die Bauform eine bessere Kühlung und geringere Trägheit, was zu einer höheren Dynamik im Fahrverhalten führt.
Technik verstehen - Vom Elektroantrieb zum Scheinwerfer
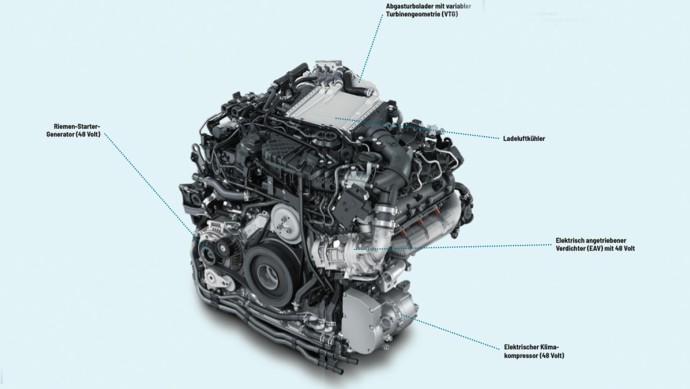 Bildergalerie
Bildergalerie
Firmen wie die britische Mercedes-Tochter YASA oder das französische Start-up Magnax haben die Technologie zur Marktreife im Auto gebracht und arbeiten bereits mit großen Herstellern zusammen. Bislang sind Axialflussmotoren allerdings nur in exklusiven Nischen zu finden. So verfügt die Hybrid-Sportler Ferrari SF90 Stradale und McLaren Artura über die Technik, Mercedes-AMG könnte ihn künftig auch in reinen E-Autos einsetzen, wie die gerade präsentierte Studie Concept GT XX andeutet.
Auch interessant:
- Wie funktioniert eigentlich: Die Domstrebe
- Wie funktioniert eigentlich: Die Scheibenheizung
- Wie funktioniert eigentlich: Die Lichtmaschine
Die Idee des Axialflussmotors ist nicht neu: Schon im 19. Jahrhundert gab es erste Konzepte, doch die damalige Fertigungstechnik erlaubte keine wirtschaftliche Umsetzung. Erst mit modernen Werkstoffen, präzisen Fertigungsverfahren und neuen Kühlkonzepten wurde das Konzept wieder interessant.
Pfannkuchen-Motor als wichtige Rolle
In den letzten Jahren hat insbesondere die Elektromobilität der Entwicklung einen starken Schub verliehen. Denn dort zählen jedes Kilogramm Gewicht, jeder Kubikzentimeter Bauraum und jeder Prozentpunkt Wirkungsgrad – Kriterien, bei denen der Axialflussmotor gegenüber klassischen Lösungen punktet. Nachteile gibt es natürlich auch: Die extrem starken Magnetkräfte verlangen steife Gehäuse und präzise Lager, sonst schleifen Rotor und Stator aneinander. Zudem sind die Motoren auf teure Seltene-Erden-Magnete angewiesen. Die Herstellung ist entsprechend komplex und teuer.
Trotzdem könnte der flache "Pfannkuchen-Motor" künftig eine wichtige Rolle spielen - mindestens als Leistungsspritze für Sport- und Luxus-EVs, als Leichtgewicht für Flugtaxis oder als platzsparender Antrieb in Stadtbussen. Gelingt es, Kosten und Materialeinsatz zu senken, könnte der Axialflussmotor vom Nischen-Akrobat zum neuen Standard reifen.









