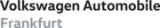Fehlerdiagnose an induktiven Sensoren
Noch immer kommt es bei der Diagnose induktiver Sensoren zu Fehlurteilen. Kenntnisse zu Aufbau, Funktionsweise und Umgebungsbedingungen helfen, diese zu vermeiden. Eine Anleitung zur sicheren Sensordiagnose.
Eine Fehlersuche an Motorsteuerung oder ABS schließt die Prüfung von induktiven Sensoren ein. Wenn das Auslesen des Fehlerspeichers „KW-Sensor kein Signal“, „ABS-Sensor defekt“ oder eine ähnliche Meldung ergibt und sich bei der Messung mit dem Multimeter am Bau-teil ein vom Hersteller-Sollwert abweichender Widerstand zeigt, ist der Sensor dann defekt oder noch in Ordnung? Man ist verleitet, den Sensor zu erneuern, doch bei einem Großteil an Zulieferer zurückgesendeter Sensoren konnten deren Ga- rantieabteilungen keinen Defekt finden. Somit stellt sich die Frage, wie es zu derart vielen Fehldiagnosen kommen kann. Zur Beantwortung muss man sich mit Aufbau, Funktionsweise und Umgebungsbedingungen induktiver Sensoren befassen.
Drehzahl- und Positionserfassung
Mit induktiven Sensoren werden vor-wiegend Drehzahlen und Positionen er- fasst. Ein solcher Sensor besteht aus einem Eisenkern, an dessen Ende ein Magnet befestigt ist. Um den Eisenkern befindet sich ein Spulenkörper, um den ein haarfeiner Kupferdraht, Durchmesser ca. 0,06 Millimeter, gewickelt ist. Je nach Sensor-ausführung beträgt die Windungszahl ca. 1.000 bis 8.000. Beide Spulenanschlüsse werden über so genannte Lötstützpunkte mit der Kabelzuführung verbunden. Um den Sensor vor Feuchtigkeit und Vibrationen zu schützen, ist die komplette Einheit mit einer Vergussmasse ausgefüllt (vgl. Bild auf Seite 11 oben rechts). Bewegen sich Zahnflanken in einem bestimmten Abstand am Eisenkern vorbei, ändert sich das Magnetfeld um den Eisenkern und in der Spule wird eine Spannung induziert.
Das Ausgangssignal ist eine Wechselspannung mit sinusähnlichem, von der Zahnflankenform des Geberrads abhängigem Verlauf sowie mit drehzahlabhängiger Höhe und Frequenz. Abhängig von der Sensorausführung, kann die Spannung im Leerlauf (vom Steuergerät getrennt) und bei maximaler Drehzahl Werte bis zu 200 Volt annehmen. Um Schäden zu ver-meiden, wird dieser hohe Spannungswert bei Anschluss an das Steuergerät an dessen Eingang auf ein zulässiges Maß begrenzt.
In der Praxis kann es durch externe Einflüsse – Temperaturschwankung, Ver-schmutzung, Kontakt mit Öl oder Feuchtigkeit, Vibration und Bewegung an der Kabelzuführung – zu Ausfällen induktiver Sensoren kommen. Alterung und Schäden durch Gewalteinwirkung sind ebenfalls potenzielle Ausfallursachen. Sollte ein induktiver Sensor in Ausfallverdacht ge- raten, könnte dessen Prüfung im eingebauten Zustand wie folgt aussehen:
Sichtkontrolle (soweit möglich, dabei auf Schäden am Sensor selbst sowie an Kontakten und Kabeln achten)
Prüfung per Multimeter (Widerstandsmessung, Sollwert = Herstellerangabe, Toleranzen bis plus/minus zehn Pro-zent können vernachlässigt werden)
Zuweilen stellt sich die Frage, ob es sich tatsächlich um einen induktiven Sensor oder womöglich um einen so genannten Hallgeber handelt. Die Frage kann recht schnell über die Widerstände beantwortet werden: Induktive Sensoren bewegen sich zwischen 500 und 1.500 Ohm, während das Multimeter bei einem Hallgeber etwa 400 Kiloohm anzeigen würde. Eine zweite Messung mit umgekehrter Polarität der Messspitzen ergibt entweder den gleichen Widerstandswert (400 Kiloohm = Hall-geber) oder einen anderen, etwas höher liegenden Messwert (= induktiver Sensor), was auf interne Elektronik hinweist.
Ein eventueller Masseschluss an einem dreipoligen Sensor (dritter Pol: Masse zur Abschirmung) kann mit dem Multimeter zwischen einem der beiden Spulenanschlüsse und der Abschirmung des Kabels oder des Sensorgehäuses ermittelt werden. Bei dieser Prüfung ist es zweckmäßig, das Anschlusskabel während der Messung zu bewegen. Insbesondere Kabel induktiver ABS-Sensoren sind ständiger Bewegung ausgesetzt. Ein Bruch der Kabelisolierung bedeutet Eintritt von Feuchtigkeit in den Sensor und somit Kurzschlussgefahr.
Ausfallursachen induktiver Sensoren
Bei Sensoren mit zweipoligen Anschlüssen kann es bei schadhafter Isolierung zum Masseschluss (Abschirmungsgeflecht) mit der Karosseriemasse kommen. Haarrisse treten vorwiegend bei Kälte in Erscheinung, bei höheren Temperaturen ist der Fehler nicht feststellbar. Der Einsatz von Kältespray ist deshalb zu empfehlen. Ein vom Sollwert abweichender Widerstand kann folgende Ursachen haben:
Widerstand zu gering: Parallelwiderstand zwischen den Spulenanschlüssen, hervorgerufen durch Oxidation im Sensorinneren oder in der Leitung
Widerstand zu hoch: Übergangswiderstand in der Leitung, oft an der Steckverbindung oder am Sensoreingang durch eine beschädigte Leitung (Feuchtigkeitseintritt und Oxidation)
Widerstand unendlich: Unterbrechung im Messkreis; Herstellerinformationen bestätigen, dass starke Vibrationen, zum Beispiel bei der Bremsscheibenmontage, die dünnen Kupferdrähte der Spule an den Lötstützpunkten brechen lassen; zudem auf Schäden an Kontakten und Kabeln achten
ein Windungsschluss der Spule ist laut Herstellerinformationen und aus praktischer Erfahrung nahezu unmöglich (gute Isolierung, niedrige Ströme)
Liegt der Sensorwiderstand im Bereich des Hersteller-Sollwerts und ist die Ausgangsspannung dennoch zu gering, kommen die folgenden Ursachen in Frage:
zu großer Abstand zum Zahnkranz des Geberrads (Magnetfeldänderungen im Eisenkern des Sensors zu schwach)
Verschmutzungen des Geberrads
Korrosion zwischen den Zahnflanken
lockeres oder beschädigtes Geberrad
beschädigter Eingangsschaltkreis des Steuergeräts (vergleichsweise selten)
Eine weitere Prüfung des Sensors, wieder im eingebauten Zustand, kann mit dem Oszilloskop erfolgen, was auch von vielen Herstellern empfohlen wird. Dabei ist die Signalamplitude bei vorgegebener Um- fangsgeschwindigkeit des Rads (Beispiel ABS-Sensor: eine Umdrehung des Rads pro Sekunde ergibt 150 bis 2.000 Millivolt) oder Motordrehzahl (beim KW- Sensor) zu messen. Vorteil: Beurteilt wird nicht nur der Sensor, sondern dessen Zusammenspiel mit dem Geberrad, so dass auch Fehler am Geberrad erkannt werden. Häufigste Ursache sporadisch auftretender Fehler (zeitweise Aussetzer etc.) sind Leitungsbrüche, die, wie bereits erwähnt, vorwiegend bei eher niedrigen Temperaturen in Erscheinung treten, und Bewegung oder zu starke Dehnung des Kabels. So kann eine zu straffe Kabelverlegung am NW-Sensor beim Gasgeben ein Aussetzen des Signals verursachen. Induktive Sensoren müssen in einem relativ weiten Temperaturbereich eine hinreichend starke Signalamplitude ab- geben können. Temperaturabhängig er- gibt sich somit ein vergleichbar weiter Widerstandsbereich, wie es links stehende Grafik belegt: Aus Temperaturen von minus 18 bis plus 50 Grad Celsius resultieren Widerstände von 450 bis 580 Ohm.
Letztlich lässt sich diese Behauptung aufstellen: Liegt der Widerstand des Sen-sors im Bereich des Sollwerts und weist der Sensor einschließlich Kontakt, Kabel und Geberrad keinen sichtbaren Schaden auf, sollte auch eine ordnungsgemäße Sensorsignalamplitude vorhanden sein.
Reinhold Dörfler
Werkstattpraxis
Korrigiertes Halbwissen
Sensor bleibt schadenfrei Die Messströme konventioneller Digitalmultimeter bei Widerstandsmessungen liegen im Bereich zwischen 0,6 Mikro- und zwei Milliampere (0,0000006 bis 0,002 Ampere). Somit kann, ganz im Gegensatz zu gegenteiligen Behauptungen, kein Schaden am Sensor entstehen. Ältere Analogmessgeräte mit höheren Messströmen bis zu 60 Milliampere (0,06 Ampere) im Niederohmbereich (0 bis 100 Ohm) sind erfahrungsgemäß in Werkstätten und Autohäusern nicht mehr zu finden.
Magnetkraft nimmt nicht ab Vermutungen, ein Magnet könne im Lauf der Zeit schwächer werden, sind falsch. Die magnetische Kraft bleibt über sehr lange Zeit quasi konstant. Laut Hersteller wird das Nachlassen der Magnetkraft auch in keinem Datenblatt beschrieben, da es verschwindend gering ausfällt. Somit kommt ein Nachlassen der magnetischen Kraft auch als Ausfallursache induktiver Sensoren nicht in Frage.
▶ Ausfallerscheinungen: Widerstand zu gering, zu hoch oder unendlich, Windungsschluss unwahrscheinlich
▶ Ausgangssignal: Wechselspannung mit sinusähnlichem Verlauf, Frequenz und Höhe sind drehzahlabhängig
Temperatur-Widerstand-Verhalten
▶ Sporadische Fehler: Leitungsbruch als Ursache, Auftreten vorwiegend bei niedrigen Temperaturen