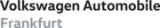Gesellschaftsrecht, Teil 1
Nicht nur Existenzgründer sollten sich die Frage nach der richtigen Rechtsform stellen. Im ersten Teil bieten wir eine Übersicht der verschiedenen Möglichkeiten.
Für viele Unternehmer, ob Existenzgründer oder alte Hasen, hat die Haftungsbeschränkung eine überragende Bedeutung. Aus diesem Grund ist die GmbH die beliebteste Rechtsform in Deutschland. Es gibt aber zahlreiche weitere Fragen, die bei der Wahl der passenden Unternehmensform bedacht werden sollten. Welche das sind, werden wir im zweiten Teil des Beitrags klären. Zunächst einmal sollen aber die verschiedenen realistischen Optionen für Kfz-Betriebe näher erläutert werden, was bedeutet, dass die Aktiengesellschaft und die Partnerschaftsgesellschaft hier nicht näher erläutert werden.
Einzelkämpfer mit Risiko
Der Einzelkaufmann ist allein tätig. Er kann unselbständige Mitarbeiter beschäftigen. Im Gegensatz zum nichtkaufmännischen Einzelunternehmer betreibt er aber entweder ein Handelsgewerbe, welches „einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Gewerbebetrieb erfordert“, oder ein Kleingewerbe. Der Einzelkaufmann haftet unbeschränkt, ist buchführungspflichtig, unterliegt den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und ist in der Regel Unternehmer im Sinne des Verbraucherschutzrechts. Bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR, §§ 705 ff. BGB) kann der Gesellschaftsvertrag mündlich und grundsätzlich sogar konkludent (z. B. durch gemeinsames Handeln) geschlossen werden. Der Gesellschafter haftet unbeschränkt. Eine Mindestkapitalausstattung ist nicht vorgesehen. Die BGB-Gesellschaft erfreut sich in der Praxis großer Beliebtheit, weil sie für eine Vielzahl von denkbaren Zwecken geeignet ist. Die Vorschriften über die BGB-Gesellschaft sehen nämlich kaum zwingende, die private Gestaltungsfreiheit einschränkende Regelungen vor. So können etwa die Höhe der Beteiligungen und des Gewinnbezugsrechts individuell geregelt werden.
Auch bei der offenen Handelsgesellschaft (OHG) haften die Gesellschafter unbeschränkt (§ 105 Abs. 1 HGB). Sie ist eine Unterart der GbR, unterscheidet sich von ihr jedoch unter anderem dadurch, dass der angestrebte Zweck der Betrieb eines Handelsgewerbes ist. Betreibt eine GbR ein Gewerbe gem. §§ 1-3 HGB, dann wird sie von Gesetzes wegen ohne jeden Publizitätsakt zu einer OHG. Auch hier kann die Höhe der Beteiligung und des Gewinnbezugsrechtes individuell geregelt werden.
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) ist die häufigste Rechtsform für kleine und mittlere Unternehmen. Sie kann von einer oder mehreren Personen gegründet werden und einen oder mehrere Geschäftsführer haben. Der Geschäftsführer kann, muss aber nicht Gesellschafter sein. Die Gründung muss vor einem Notar beurkundet werden. Anschließend muss die GmbH in das Handelsregister eingetragen werden. Ihre Gründungsdauer variiert regional. Meist ist die Gründung innerhalb weniger Tage möglich.
Vorzug Haftungsbeschränkung
Die GmbH ist mit einem Stammkapital ausgestattet. Dieses stellt ihre finanzielle Grundausstattung dar. Für so genannte Sachgründungen (z. B. Einbringung von Werkzeugen oder Maschinen statt Geld) gelten Sonderregeln. Zu beachten ist, dass das Stammkapital von derzeit 25.000 Euro nicht an den Unternehmer zurückgezahlt, wohl aber für das operative Geschäft ausgegeben werden darf. Es muss grundsätzlich nur zur Hälfte eingezahlt werden, jedoch wird die zweite Hälfte im Falle der Insolvenz eingefordert. Der große Vorteil der GmbH liegt in der Haftungsbeschränkung. Dritte – also vor allem Kunden – können grundsätzlich nicht auf das Privatvermögen der Gesellschafter oder der Geschäftsführer zugreifen. Allerdings ist sie buchführungs- und körperschaftssteuerpflichtig. Verluste „bleiben in der GmbH“, können also nicht mit positiven anderen Einkünften der Gesellschafter verrechnet werden. Somit ist die GmbH für verlustträchtige Unternehmen zumeist nicht die richtige Rechtsform.
Gründungen mit wenig Kapital
Die Limited (Ltd., richtig: Private Limited Company) ist eine Gesellschaft britischen Rechts. Der satzungsmäßige Sitz ist zwingend in Großbritannien. Dort ist sie auch im Handelsregister (Companies House) eingetragen. In Deutschland existiert rechtlich nur eine Zweigniederlassung, auch wenn das operative Geschäft zu 100 Prozent in Deutschland stattfindet. Die Zweigniederlassung muss auch in das deutsche Handelsregister eingetragen werden, andernfalls drohen Bußgelder.
Den vermeintlichen Vorteilen der Ltd. (schnelle Gründung, fast kein Mindestkapital) stehen viele Nachteile (u. a. doppelte Buchführungspflicht in D und GB) gegenüber. Vielfach wird die Ltd. am deutschen Markt auch als unseriös angesehen.
Seit Einführung der Unternehmergesellschaft (UG) bietet das deutsche Gesellschaftsrecht eine Alternative zur Ltd., auf die zurückgegriffen werden sollte, falls die Kapitalausstattung zur Gründung einer GmbH nicht ausreichend ist. Die UG, die mit einem Stammkapital von einem Euro gegründet werden kann, muss in ihrer Firma den Rechtsformzusatz „Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)“ oder „UG (haftungsbeschränkt)“ führen. Das gewählte Stammkapital ist bei der Gründung voll einzuzahlen, eine nur teilweise Erbringung ist ebenso wenig zulässig wie Sacheinlagen zur Aufbringung des Stammkapitals bei der Gründung. Bei der UG ist eine gesetzliche Rücklage vorgeschrieben: ein Viertel des Jahresüberschusses. Diese Rücklage darf ausschließlich für eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln verwandt werden. Ein Verstoß hiergegen hat letztlich Rückzahlungsansprüche gegen die Gesellschafter zur Folge. Zudem machen sich die Gesellschafter persönlich haftbar (§ 43 GmbHG). Die Kommanditgesellschaft (KG) muss als Sonderform der OHG verstanden werden. Infolgedessen sind auf die KG, soweit sich aus den §§ 161 HGB nichts anderes ergibt, die Vorschriften über die OHG und diejenigen über die GbR anzuwenden. Die KG ist wie die OHG eine Gesellschaft, deren Zweck in der Regel auf den Betrieb eines Handelsgewerbes unter gemeinschaftlicher Firma gerichtet ist. Sie ist keine juristische Person, sondern eine rechtsfähige Personengesellschaft. Kraft Gesetzes ist sie stets Kaufmann (§ 6 HGB).
Begrifflich gehört zur KG, dass es zwei Arten von Gesellschaftern gibt, von denen mindestens je einer vorhanden sein muss:
Der persönlich haftende Komplementär, der im Wesentlichen die gleiche Stellung wie die OHG-Gesellschafter hat.
Der Kommanditist, dessen Haftung den Gesellschaftsgläubigern gegenüber auf den Betrag einer bestimmten Vermögenseinlage beschränkt ist. Er ist in der Regel von der Geschäftsführung ausgeschlossen und zur Vertretung der Gesellschaft nicht befugt.
Insbesondere die Möglichkeit bei der KG, eine GmbH zum einzigen persönlich haftenden Gesellschafter zu machen, bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich. Kein Gesellschafter der KG haftet mit seinem Privatvermögen, soweit die Kommanditisten ihre Einlage geleistet haben. Bei allen Gesellschaftern ist die Haftung dann auf die Einlage beschränkt, weil die GmbH als persönlich haftende Gesellschafterin der KG selbst nur mit ihrem Gesellschaftsvermögen haftet.
Die GmbH & Co. KG ähnelt insbesondere der Haftungsbeschränkung der GmbH. Durch den „Trick“, dass eine GmbH und eine KG verknüpft werden, vermeidet sie den steuerlichen Hauptnachteil der GmbH. Anders als bei dieser können hier die Verluste mit anderen positiven Einkünften der Gesellschafter verrechnet werden. Deswegen ist diese Gesellschaftsform gerade im Mittelstand weit verbreitet. Wegen der Verschachtelung zweier Gesellschaften sind jedoch Gründung und Pflege komplizierter. RA Jürgen Leister, Heidelberg