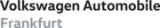Entscheidungshilfe
Wichtige Kriterien
Auch wenn die Entscheidung für eine bestimmte Rechtsform nicht endgültig sein muss, ist der Wechsel mit Aufwand und Kosten verbunden.
Vorab sollten daher u.a. folgende Kriterien sorgfältig abgewogen werden:
Geschäftsführung:Besteht die Bereitschaft einen gleichberechtigten Mitunternehmer zu akzeptieren oder sollen alle Fäden in eigenen Händen bleiben?
Kosten:Besteht die Möglichkeit einen hohen Gründungsaufwand zu tragen?
Steuerliche Gesichtspunkte/Gewinn- und Verlustrechnung:Welcher private Finanzbedarf besteht; bestehen noch andere Erwerbsquellen?
Eigen- und Fremdfinanzierung:Welche Eigenmittel sind vorhanden, in welcher Höhe wird Kredit benötigt?
Haftung und Risikoverteilung:Besteht die Bereitschaft mit dem Privatvermögen zu haften?
Nachfolgeregelung:Sind Kinder vorhanden, die Kenntnisse der Kfz-Branche haben; wie soll der Betrieb an etwaige Erben/Nachfolger übertragen werden?
Gesellschaftsrecht, Teil 2
Nachdem in der September-Ausgabe die für einen mittelständischen Kfz-Betrieb in Betracht kommenden Rechtsformen vorgestellt wurden, bieten wir nun eine Entscheidungshilfe anhand des erfundenen Schicksals von Kfz-Meister Karl Kolbe.
Welche Rechtsform ist für welchen Unternehmer geeignet? Um auf diese Frage eine passende Antwort zu finden, muss zunächst eine Grundsatzentscheidung getroffen werden: Will man als Einzelunternehmer das Sagen haben, aber auch das alleinige Risiko tragen, mit dem Geschäftskapital auch sein Privatvermögen aufs Spiel zu setzen? Herr Kolbe beispielsweise hat sich festgelegt: Der ange-stellte Meister in einer großen Werkstatt will nicht immer nach Vorgaben arbeiten. Eigenkapital besitzt er zwar nicht, aber er ist risikobereit. Er meldet ein Gewerbe an und schraubt ein Schild vor seine kleine angemietete Werkstatt: „Karl Kolbe, Kfz-Meisterbetrieb“. Seine Frau kümmert sich um die monatlich zu erledigende Buchhaltung nach Anweisung eines Kunden, der Steuerberater ist. Schon ist das Einzelunternehmen gegründet und am Markt. Karl Kolbe genießt es zunächst, dass kein Chef ihn mehr herumschubst, allerdings vermisst er mit zunehmenden Aufträgen auch Freizeit und bezahlten Urlaub. Ein Partner im Betrieb könnte Entlastung schaffen.
Kompetenzen ergänzen
Für die Partnerschaft in einer Gesellschaft spricht die nicht zu unterschätzende Möglichkeit, Stärken und Kompetenzen zu ergänzen. Wenn Sie mit einem Partner oder einer Partnerin ein Geschäft eröffnen wollen, kann die Offene Handelsgesellschaft (OHG) die richtige Rechtsform für Sie sein. Im Bereich der Kfz-Betriebe wird die OHG regelmäßig an die Stelle einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts treten (s. Teil 1 der Serie). Für Verbindlichkeiten haften die Gesellschafter neben ihrem Gesellschaftsvermögen auch mit ihrem Privatvermögen. Wegen dieser Bereitschaft zur persönlichen Haftung steht eine OHG bei Kreditinstituten und Geschäftspartnern in hohem Ansehen. Zudem wird bei der OHG kein Mindestkapital verlangt. Damit wären die wichtigsten Vor- und Nachteile bereits genannt.
Die Kommanditgesellschaft (KG) ist eine nur für Vollkaufleute im Sinne des HGB zugelassene Rechtsform. Bei der KG ist die Haftung eines oder mehrerer Gesellschafter auf einen genau bezifferten Betrag, die Kommanditeinlage, beschränkt. Die beschränkt haftenden Gesellschafter heißen Kommanditisten, die voll haftenden Komplementäre. Die Kommanditisten haben daher keine Befugnis Geschäfte im Namen der Gesellschaft zu führen oder diese zu vertreten. Dies bleibt den Komplementären vorbehalten, die auch das höhere Risiko tragen. Die Kommanditisten unterliegen wiederum keinem Wettbewerbsverbot. Herr Kolbe hat sich für die KG entschieden: Seine Frau ist inzwischen schwanger und er fürchtet, dass Werkstatt und Familie nicht alleine zu stemmen sind. Er berät sich mit seinem Steuerberater und nimmt Kontakt zu Werner Wankel auf, einem Gesellen aus seinem alten Betrieb. Er schlägt ihm vor, seinen Betrieb in eine Kommanditgesellschaft umzuwandeln und er solle Kommanditist werden. Kolbe geht zu seiner Hausbank, um dort für Wankel einen Kredit über die Höhe seiner Kommanditeinlage auszuhandeln. Herr Kolbe haftet zwar als Komplementär mit seinem gesamten Vermögen, dafür ist es aber immer noch „sein“ Betrieb. Der Jungkommanditist darf sich auch als Unternehmer fühlen, ohne volles Haftungsrisiko, aber auch ohne vollständige Geschäftsführungsbefugnis. Alle sind zufrieden und vor der Werkstatt wird ein neues Schild aufgehängt: „Kolbe & Wankel KG“.
Viel Arbeit, wenig Ertrag
Über mehrere Jahre arbeiten die beiden erfolgreich zusammen. Inzwischen hat sich herumgesprochen, dass insbesondere die markenunabhängige Unfallinstandsetzung von höchster Qualität ist. Ein großer Versicherungskonzern tritt an Kolbe heran und lockt mit einem Rahmenabkommen, das eine große Anzahl von Haftpflicht- und Kaskoschäden in die Werkstatt steuern soll. Der Preis hierfür ist aber eine erhebliche Reduzierung der Stundenverrechnungssätze. Tatsächlich expandiert die Werkstatt erheblich. Es wird ein neues Betriebsgelände angemietet und drei Mitarbeiter eingestellt. Nach einiger Zeit merken beide, dass sie sich vor Arbeit zwar nicht mehr retten können, aufgrund der verminderten Stundenverrechnungssätze und der höheren Kosten am Monatsende aber nicht viel übrig bleibt.
Nachfolge gesichert
Im Hinblick auf seine persönliche Haftung wird Kolbe nun doch unruhig und so wendet er sich an seinen Steuerberater. Dieser schlägt vor, die KG in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) umzuwandeln, da die Haftung auf diesem Weg beschränkt werden kann. Nach entsprechender rechtlicher Beratung beschließen Kolbe und Wankel die Umwandlung und bringen ihre Beteiligungsrechte gegen Gewährung von Geschäftsanteilen in die GmbH ein. Beide werden zu Geschäftsführern bestellt und jeweils ein Dienstvertrag abgeschlossen. Und wieder wird ein neues Firmenschild angeschraubt: „Kolbe & Wankel Kfz-Instandsetzung GmbH“.
Auch Frau Kolbe ist froh, dass sie endlich die Buchhaltung los wird. Im Hinblick auf die strengen Bilanzierungsvorschriften muss sie nun nur noch monatlich die Belege vorsortiert zu ihrem Steuerberater bringen, der dann den Rest erledigt. Das kostet zwar, führt aber zu einer deutlichen Entlastung, zumal Karl zwischenzeitlich einen zweiten Sohn hat. Wie sich später zeigen wird, ist dieser allerdings aus der Art geschlagen und studiert Jura. Sein ältester Sohn übernimmt aber den Betrieb und führt ihn zusammen mit Herrn Wankel fort. Durch ein Unternehmertestament mit Nachfolgeregelung kann dieses umgesetzt werden; auch insoweit bietet die neue GmbH Vorteile. RA Jürgen Leister, Heidelberg