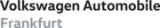Starterbatterien mit historischem Erscheinungsbild
Zur Pkw-IAA im September 2013 präsentierte Bosch neu entwickelte Starterbatterien mit historischem Erscheinungsbild. Ein passender Anlass, den diesbezüglichen Gesamtmarkt unter die Lupe zu nehmen.
Bei Arbeiten an Klassikern unterläuft selbst erfahrenen Fachleuten häufig ein Fehler: Sie verwenden für bis in die 1960er Jahre gebaute Fahrzeuge moderne, wartungsfreie Starterbatterien mit verschlossenen Gehäusen. Begründen lässt sich diese falsche Wahl weder mit einem Mangel an neuen Batterien mit historischem Erscheinungsbild noch mit deren Kosten. Vermutlich wird schlicht nicht daran gedacht, dass auch das vermeintliche Nur-Verschleißteil Starterbatterie eine historisch bedeutsame und somit erhaltenswerte Technikkomponente darstellt. Hinzu kommt die verheerende optische Wirkung. Beispiel, erlebt bei der Oldtimer-Rallye Ennstal-Classic: Als der Besitzer des im Bild gezeigten Ferrari 275 GTB – laut Classic-Data-Erhebung auch in Zustand 2 noch ein Millionenobjekt – die Motorhaube öffnete, verflog der Zauber des 1960er-Jahre-Sportwagens sofort und es wurde klar, dass die Servicebetreuung als nur bedingt professionell einzustufen ist.
Die Entwicklung der Starterbatterie-Gehäuse am Beispiel von Bosch verdeutlicht, welche Fahrzeug-Batterie-Kombinationen historisch korrekt erscheinen:
1927 (Start der Batteriefertigung beim Zulieferer) bis 1954 (Motorräder) bzw. bis 1958 (Pkw) werden Batteriekästen aus Hartgummi hergestellt
danach bestehen Batteriekästen aus Polystyrol (PS), besitzen jedoch noch immer außen liegende Polbrücken und vergossene Deckel
1968 kommt die erste Batterie mit verschlossenem Gehäuse auf den Markt
1973 sind sämtliche Starterbatterie-Bauarten auf verschlossene Gehäuse umgestellt
Frühzeit: Kästen aus Holz oder Glas
Historisch korrekt für den von 1964 bis 1968 produzierten Ferrari 275 GTB wäre somit eine Starterbatterie in Kasten-Bauweise, mit außen liegenden Polbrücken und vergossenem Deckel. Übrigens wurden in der Frühzeit der Autobatterie Kästen aus imprägniertem Holz oder transparentem Glas verwendet.
Vergleichbare Maßstäbe lassen sich bei den Zellenmaterialien leider nicht anlegen. Sie wurden unter Beibehaltung des Wirkprinzips des Blei-Säure-Akkumulators zwar nur gering, aber konti-nuierlich weiterentwickelt. Wann welches Detail an den Platten oder Separatoren verändert wurde – größere Schritte jüngeren Datums, zum Beispiel AGM- oder Rundzellenbatterien, selbstverständlich ausgenommen –, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen, geschweige denn in den eher geringen Stückzahlen aktuell gefertigter Starterbatterien mit historischem Erscheinungsbild umsetzen. So muss man akzeptieren, dass selbst eine Starterbatterie mit Hartgummi-Kasten ein modernes Innenleben besitzt.
Während der Pkw-IAA im September zeigte Bosch neu entwickelte Starterbatterien mit historischem Erscheinungsbild. Zunächst beschränkt auf sechs Volt Nennspannung, stehen sechs Nennkapazitäten zur Verfügung: 8 (Motorrad), 66, 77, 84, 98 und 112 Amperestunden. Ihre Startleistung wurde um rund 70 Prozent gesteigert, so der Zulieferer. Ausgeliefert werden die Batterien trocken vorgeladen. Ebenfalls ca. sechs wichtige Kapazitätsstufen von Zwölf-Volt-Starterbatterien sollen voraussichtlich Ende 2014 folgen. Die Gehäuse der Batterien sind aus Polycarbonat gefertigt und verschlossen; die Vergussmasse auf den Deckeln ist nur angedeutet. Gehäuseabmessungen und Befestigungsarten (Bügel und/oder Bodenleisten frontal oder seitlich) entsprechen historischen Vorbildern. Künftig soll in die Schraubdeckel noch ein Rückzündschutz integriert werden.
Polklemmen, Polfett, Ladegerät
In der Klassik-Abteilung des Zulieferers hat man auch die Batterieperipherie im Blick. Polklemmen sind nach wie vor lieferbar. Derzeit nur in größeren Tuben bestellbares Polfett soll bald auch in kleineren Gebinden zur Verfügung stehen. Auch ein neues Sechs-Volt-Ladegerät soll auf den Markt kommen, denn der Ladestrombereich noch lieferbarer Geräte ist auf Motorradbatterien abgestimmt.
Batterie selbst zusammenbauen
Wer andere Starterbatterien mit historischem Erscheinungsbild als solche mit Gehäuse aus Polycarbonat und nur angedeuteter Vergussmasse bevorzugt, muss nicht lange suchen. Anbieter gibt es genug; neben Batterien mit Hartgummi-Kasten, außen liegenden Polbrücken und vergossenem Deckel sind vereinzelt sogar deren Nachfolger lieferbar: solche mit geschlossenem Kunststoffgehäuse und Schraubdeckeln in Schwarz oder Weiß, typisch für die 1970er Jahre (vgl. Tabelle unten). Ein Anbieter treibt es auf die Spitze: „Ein besonderes Technikerlebnis bieten wir Oldtimerfans dergestalt an, dass sie am Standort Frauenhagen, unter fachlicher Anleitung unserer Batterie-experten, ihre Hartgummi-Batterie selbst von Hand zusammenbauen können“, so Klaus Weise von Batterie Zippel.
Übrigens waren Starterbatterien mit Hartgummi-Kasten, außen liegenden Polbrücken und vergossenem Deckel in der DDR noch bis in die 1980er Jahre, also bis zuletzt, weit verbreitet. Ebenso die Vorgehensweise, eine defekte Batterie – meist ging es nur um eine Zelle – nicht zu entsorgen, sondern instandzusetzen oder ggf., beginnend vom Hartgummi-Kasten, vollständig neu aufzubauen – eine Möglichkeit, die nur diese Starterbatterie-Bauart bietet. Peter Diehl
Kommentar
Wichtige Ersatzteile nachfertigen oder aufbereiten, eigene und in Partnerbetrieben vor- handene Kompetenzen erkennen und bün-deln, Wissen in Trainings weitergeben – bei Bosch hat man die Bedürfnisse der Klassikszene erkannt. Nicht nur vor diesem Hintergrund enttäuschen die vom Zulieferer neu entwickelten Starterbatterien mit historischem Erscheinungsbild. Mag sein, dass die 2010 präsentierten Nachfertigungen von Gleichstrom-Reglern elektronische Innenleben erhalten mussten, um die Kosten in Grenzen zu halten. Auch diesmal argumentiert man bei Bosch mit den Kosten (und der Produkthaftung). Doch Wettbewerber, sogar deutsche mit Inlandsfertigung, zeigen, dass man Starterbatterien mit Hartgummi-Kästen und ver-gossenen Deckeln durchaus produzieren und verkaufen kann. Auch aus Sicht des Marken-images ist die Entscheidung für Polycarbonat-Gehäuse und Deckel mit nur angedeuteter Vergussmasse unverständlich: Das Bosch-Logo prangt auf Attrappen. Peter Diehl
Inbetriebnahme
Starterbatterien mit historischem Erscheinungsbild werden auch heute noch trocken vorgeladen geliefert und gelagert. Vor ihrer Inbetriebnahme sind sie mit Elektrolyt zu füllen und vollständig zu laden. Konkret:
Befüllung mit wässriger Schwefelsäure fünf bis zehn Millimeter über den oberen Rand der Plattensätze (nach einigen Stunden sind die Platten durchtränkt, so dass der Elektrolytpegel gesunken ist und korrigiert werden muss)
Ladung mit einem Zwanzigstel der Nennkapazität in Ampere (Beispiel: bei einer 84-Ah-Batterie bedeutet das eine Ladespannung von 4,2 A); zum Laden die Verschlussschrauben der Zellen entfernt lassen
„es ist so lange zu laden, bis alle Zellen lebhaft und gleich-mäßig gasen, die Zellenspannung etwa 2,5 bis 2,7 V erreicht hat und die Säuredichte 1,28 g/cm3 [...] beträgt und diese Werte während der nächsten zwei bis drei Ladestunden nicht mehr ansteigen“ (Zitat aus dem Lehrbuch „Kfz-Elektrik“, Transpress-Verlag Berlin, 1988)
während des Ladens darf die Elektrolyttemperatur nicht über 50 Grad Celsius steigen, sonst ist Ladestrom zu verringern oder Ladung zu unterbrechen