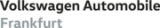Aufbau und Funktion von Kfz-Klimaanlagen
Wer Servicearbeiten an Kfz-Klimanlagen ausführen will, muss wissen, wie diese funktionieren.Wie so oft im Auto hat auch hier längst die Elektronik die Regie übernommen und sorgt für feinfühlige Regelung und effizienten Betrieb des Klimasystems.
Noch vor 20 Jahren wurden Klimaanlagen in Pkw als verzichtbarer Luxus abgetan. Sie waren daher meist Luxusfahrzeugen vorbehalten. Mit der Kostensenkung bei der Produktion erlebten Kfz-Klimaanlagen in Deutschland in den 1990er Jahren einen regelrechten Boom. Heute gehört die Klimaanlage bei allen Pkw, aber auch Lkw, zur Standardausstattung. Sie sind sogar derart selbstverständlich geworden, dass Gebrauchte ohne Klimaanlage nahezu unverkäuflich sind.
Die Vorteile einer Klimaanlage liegen klar auf der Hand. Sie sorgt nicht nur für kühle, sondern auch für entfeuchtete Luft im Innenraum des Fahrzeugs. Hierdurch empfindet nicht nur der Fahrer einen Komfortanstieg, der besonders im Sommer bei großer Hitze für höhere Konzentration und damit Fahrsicherheit sorgt.
Täglich extreme Einsatzbedingungen
Doch was auf der einen Seite für Fahrer und Insassen angenehm ist, bedeutet auf der anderen Seite Schwerstarbeit, denn die Einsatzbedingungen, unter denen moderne Klimaanlagen in Fahrzeugen arbeiten müssen, sind extrem. Vergleicht man die Anforderungen mit denen an eine stationäre Klimaanlage in Gebäuden, zeigt sich schnell, um wie viel schwerer die zufriedenstellende Klimatisierung eines Automobils ist. Störfaktoren, wie Sonneneinstrahlung, Schatten, Niederschlag, Wind, Geschwindigkeit des Fahrzeugs, Motordrehzahl, aber auch Anzahl der Mitfahrer, Beladung und Wärmeabstrahlung von Motor und Getriebetunnel uvm. sind hier zu berücksichtigen. Bei der Konstruktion und den Funktionen der Klimaanlage geht daher heute ohne elektronische Steuerungen nichts mehr. Trotz dieser hohen Anforderungen an eine Klimaanlage ist ihr Aufbau und damit ihre Funktionsweise in allen Fahrzeugen nahezu identisch. Lediglich die Bauarten einzelner Komponenten können sich unterscheiden.
Prinzipiell besteht eine Klimaanlage stets aus den Bauteilen Kompressor, Verflüssiger (Kondensator), Sammler oder Trockner, Expansionsventil, Verdampfer und Gebläse. Im so genannten Hochdruckteil der Klimaanlage verdichtet der vom Motor im Regelfall über eine Magnetkupplung angetriebene Kompressor das gasförmige Kältemittel (heute R134a), das sich hierbei erhitzt. In diesem Zustand wird es über eine Rohrleitung dem Kondensator zugeführt, wo das Kältemittel abkühlt und sich verflüssigt. Zur Erhöhung der Kondensationsleistung kann ein am Kondensator angebrachter Lüfter zum Einsatz kommen. Die vom Kältemittel zugeführte Wärme wird so leichter abgeführt.
Ein Grundprinzip, mehrere Varianten
Anschließend gelangt das abgekühlte und verflüssigte Kältemittel über eine weitere Leitung zum Sammler oder Trockner, wo Schwebstoffe und Feuchtigkeit ausgefiltert und das flüssige Kältemittel gesammelt werden. Danach wird es über ein Expansionsventil, in einigen Fällen auch über eine so genannte Konstantdrossel, im Niederdruckteil der Klimaanlage in den Verdampfer eingespritzt. Die dort zur Verdampfung des Kältemittels notwendige Wärme wird über das Lüftungsgebläse der eintretenden Umgebungsluft entnommen. Dabei kühlt die Luft stark ab und kann dann zur Kühlung der Fahrgastzelle ins Fahrzeuginnere geleitet werden. Gleichzeitig fällt die von der Umgebungsluft mitgeführte Feuchtigkeit als Kondensat aus, das über einen Schlauch abläuft. Die damit erzielte Trocknung der Luft ist im Übrigen erwünscht, da sich so ein Beschlagen der Scheiben von innen verhindern lässt. Zur Regelung der Lufttemperatur befindet sich der Verdampfer im Frischluftstrom vor dem Heizungswärmetauscher. So kann die nur relativ grob durch Ein- und Ausschalten des Kompressors regelbare, jedoch stets unterkühlte Luft im Heizungswärmetauscher feinfühlig wieder erwärmt werden. Nach dem Verdampfen des Kühlmittels wird dieses völlig gasförmig über eine Saugleitung mit zwischengeschaltetem Expansionsventil erneut dem Kompressor zugeführt. Der Kühlmittelkreislauf endet und beginnt von neuem. Klimaanlagen produzieren demnach Kälte gemäß dem physikalischen Prinzip, dass eine verdampfende Flüssigkeit ihrer Um-gebung Wärme entzieht. Dieser Kühleffekt entspricht in der Natur u.a. dem schweißnasser Haut, die Wind ausgesetzt ist.
Je nach Einsatzbedingungen und Fahrzeugtyp können sich die heute verbauten Klimaanlagen bei ihren Komponenten unterscheiden. Um die Kälteleistungen von drei Kilowatt und höher bereits bei niedrigeren Fahrgeschwindigkeiten oder im Leerlauf zu erreichen, werden allerdings nur Kompressionskälteanlagen verwendet. Beim Kompressor kommen deshalb zwei Bauarten zur Anwendung: Hubkolben- (Reihen-, Radial-, Axial- oder Taumelscheiben-Bauweise) und Rotationsverdichter-Kompressoren (Flügelzellen-, Rotationskolben- oder Spiralverdichter-Bauweise), wobei es sich stets um ölgeschmierte Verdrängungsverdichter, die direkt vom Verbrennungsmotor über Riementrieb und Elektromagnetkupplung angetrieben werden. Alle Kompressoren müssen in einem Betriebsdrehzahlbereich zwischen ca. 500 und 8.000/min und bei Umgebungstemperaturen von etwa 120 Grad Celsius arbeiten können. Vor allem wird von ihnen ein hoher Liefergrad bei niedrigen Drehzahlen abgefordert. Der Kompressor selbst muss dabei ein geringes Bauvolumen bei gleichzeitig niedriger Geräuschentwicklung und Gewicht erfüllen. Darüber hinaus müssen sie mindestes 100.000 Kilometer oder 2.000 Betriebsstunden wartungsfrei arbeiten.
Obwohl es drei Kondensatorarten zur Verflüssigung eines Kältemittels gibt (Luftkühlung, Wasserkühlung und Verdunstungs-Kondensator) wird bei Kraftfahrzeugen aufgrund der einfachen Bauart der luftgekühlte Kondensator verbaut. Der Aufbau des Kondensators ist vergleichbar mit dem eines Motorkühlers (Rohre mit Kühlrippen, Lamellen). Eingebaut wird er meist vor dem Motorkühler, weshalb er möglichst flach sein und geringen Luftwiderstand aufweisen sollte, um die Motorkühlung nicht zu beeinflussen.
Verschiedene konstruktive Vorlieben
Die Entwicklung der letzten Jahre führte deshalb dazu, dass europäische und amerikanische Hersteller vorwiegend Rundrohr-Kondensatoren bauen, während sich in Japan Serpentinen-Kondensatoren durchgesetzt haben. Der Sammler oder Trockner dient als Vorratsbehälter und Ausgleichsgefäß für das verflüssigte Kühlmittel. Sein Aufbau ist bei allen Kfz-Klimaanlagen gleich. Die in den Sammler integrierte Trocknerpatrone besteht aus einem Sieb für die Entfernung von Fremdkörpern, einem Trockenmittel zur Absorption der Feuchtigkeit aus dem Kältemittel, einem Schauglas zur Überprüfung der Kältemittelmenge und einem Niederdruckschalter (Hoch- und Niederdruckschalter, Trinary), der den Kompressor abschaltet, wenn der Druck auf der Hochdruckseite des Systems zu niedrig oder zu hoch ist. Da die Menge des zirkulierenden Kältemittels abhängig von der Wärmebelastung der Klimaanlage variiert, ist ein Flüssigkeitsbehälter erforderlich. Hier wird das pul-sierende Kältemittel beruhigt. Das Kältemittel sammelt sich unterhalb des Doms, wo es sich am Boden des Trockners mit dem dort gespeicherten Kältemittelöl sättigt und schließlich abgesaugt wird.
Zirkulierendes Kältemittel
Das dem Sammler nachgeschaltete Ex-pansionsventil reguliert abhängig von der Temperatur des Kältemitteldampfs im Verdampfer den Kältemittelstrom zum Verdampfer. Es gelangt daher nur soviel Kältemittel in den Verdampfer, wie ab-hängig von der abgeforderten Kühlleistung dort auch verdampfen kann. Es stellt das Gleichgewicht zwischen Zufluss und Ab-saugung sicher, um die Wärme über-tragenden Verdampferflächen voll ausnutzen zu können. Das Expansionsventil ist zugleich auch die Trennstelle zwischen Hoch- und Niederdruckteil.
Von dieser Technik unterscheiden sich Klimaanlagen mit so genannter Konstant- oder Festdrossel. Hier fließt das flüssige Kältemittel vor dem Verdampfer durch eine Engstelle, die den Durchfluss des Kältemittels drosselt. Vor dieser Drossel ist das Kältemittel unter hohem Druck (bei R 134a ca. 8 bis 18 bar, je nach Temperatur) warm. Mit dem Passieren der Drossel erfolgt ein rapider Druckabfall auf 1,2 bis 2,35 bar (R134a), wobei das Kältemittel aufgrund seiner Verdampfung abkühlt. Die Drossel bildet auch hier die Trennstelle zwischen Hochdruck und Niederdruckseite der Klimaanlage. Die Durchflussmenge des Kältemittels wird durch eine speziell kalibrierte Bohrung gewährleistet, durch die nur eine dem Druck entsprechende Menge des Kältemittels fließen kann. Bei Klimaanlagen mit Drosselregelung ist anstelle des Sammlers oder Trockners in der Hochdruckseite ein Auffangbehälter (Sammler) in der Niederdruckseite verbaut. Er dient als Vorratsbehälter (Öl) und als Schutz für den Kompressor (Flüssigkeitsschlag). Bei Klimaanlagen mit Konstant- oder Festdrossel werden Nieder- und Hochdruck oft durch zwei Sicherheitsschalter überwacht, die bei Unter- (ca. 1,7 bar) oder Überschreiten (ca. 30 bar) des Arbeitsdrucks den Kompressor über die Magnetkupplung abschalten.
Verdampfer als Quelle der Kälte
Im Verdampfer wird das flüssig eingespritzte Kältemittel in den gasförmigen Zustand überführt. Grundsätzlich können zwei Bauarten von Verdampfern unterschieden werden: überflutete Verdampfer (Scheibenverdampfer) und Trockenexpansionsverdampfer (Rundrohr- oder Serpentinenverdampfer).
Um ein einwandfreies Zusammenspiel der einzelnen Klimaanlagenkomponenten zu gewährleisten, wird dieses bei modernen Fahrzeugen elektronisch gesteuert. Die Klimaanlagensteuerung wertet dabei ständig Informationen über den Zustand des Fahrzeugs, zum Beispiel Kühlmitteltemperatur, Motordrehzahl, Stellung der Außenluftklappen, Gebläsestufe, Innen- und Außentemperatur und Kühlmitteldruck aus. Zusätzlich sind das Temperaturniveau der Kältemittel- und Heizungskreisläufe zu überwachen und einzuregeln. Vollautomatische Anlagen können dank Sensoren nicht nur die eingestellte Innenraumtemperatur konstant halten, sondern unterschiedliche Temperaturzonen realisieren. Im Mittelklasse-, aber auch zu-nehmend im Kleinwagensegment werden heute halbautomatisch geregelte Klimaanlagen verbaut. Sie halten die gewählte Innentemperatur konstant, die Luftverteilung muss jedoch manuell an die Außenbedingungen und die Fahrweise angepasst werden. Da der Betrieb des Klimakompressors über seinen Arbeitswiderstand zu einem Mehrverbrauch des Motors führt (erfahrungsgemäß 0,4 bis 4,5 Liter; bei Anlagen mit Konstant- oder Festdrossel deutlich mehr als bei Anlagen mit Expansionsventil), regeln voll- und teilautomatische Klimaanlagen auch die Magnetkupplung des Kompressors mit.
Global Warming Potential (GWP)
Manuell zu regelnde Klimaanlagen sind dem Billigfahrzeugsegment vorbehalten. Hier sind Gebläsestufe, Luftverteilung und Temperatur von Hand einzustellen. Ab 2011 verbietet eine EU-Richtlinie stufenweise den Einsatz von Kältemitteln mit einem Global Warming Potential (GWP; Treibhauspotenzial) größer 150; zunächst bei neu typgeprüften Fahrzeugen, später bei allen Neuwagen. Darunter fällt auch das bisherige Kältemittel R134a. Als Ersatz war im letzten Jahrzehnt von Kohlendioxid die Rede. Kältemittelkürzel: R744. Etwa seit Jahresbeginn 2010 ist allerdings klar, dass die diesbezüglichen Erklärungen der Automobilhersteller ebenso wie die Entwicklungsarbeiten der Zulieferer nichts mehr wert sind. Die Produzenten des bisherigen Kältemittels R134a, Honeywell und DuPont, haben ein alternatives Kältemittel mit der Bezeichnung HFO-1234yf entwickelt. Das Kältemittel, ebenfalls ein Fluorkohlenwasserstoff (FKW), wird vermutlich Vor- und Nachteile aufweisen. Genaueres mitzuteilen, fällt zu diesem Zeitpunkt schwer, weil beide Unternehmen nicht sonderlich kommunikativ auftreten. Aussagen von Greenpeace zufolge kann HFO-1234yf nicht als harmlose Chemikalie betrachtet werden: „Dass anscheinend selbst Kältemaschinenöle (PAG) mit HFO in der Klimaanlage zu Fluorwasserstoff (HF) zersetzt werden, ist ein deutlicher Hinweis auf die geringe Stabilität und damit hohe Reaktionsfähigkeit dieser Substanz.“ „Bei einem Unfall mit dem neuen brennbaren Kältemittel entsteht hochgiftiger Fluorwasserstoff. Das erschwert nicht nur die Rettungsarbeiten, es führt in realistischen Unfallszenarien zu unzähligen Schwerverletzten und Toten.“
Honeywell hält dagegen: „Im Entwicklungsprozess hat Honeywell intensive Tests durchgeführt. ... Die Tests haben deutlich gemacht: HFO-1234yf ist ein sicheres Produkt für den Einsatz in Autoklimaanlagen. HFO-1234yf ist eine ‚near drop-in Solution‘. Das bedeutet, dass nur geringfügige Änderungen notwendig sind, um HFO-1234yf anstelle von R134a einzusetzen.“ In der Tat wären für Kohlendioxid (R744) als Kältemittel einige Änderungen an Aufbau und Funktion der Klimaanlage nötig. Stichworte: Erhöhung des Betriebsdrucks um den Faktor 5, innerer Wärmeübertrager als zusätzliches Bauteil und geänderte Dichtungen, denn Kohlendioxid ist ein Elastomer-Lösemittel.
Technik und Besonderheiten bleiben
Unabhängig vom verwendeten Kältemittel werden die grundsätzliche Technik und die Besonderheiten des automobilen Ein-satzes von Klimaanlagen erhalten bleiben. Dennoch erfordern veränderte Details ebensolche Weiterbildung (vgl. Seite 55).
Marcel Schoch, Peter Diehl